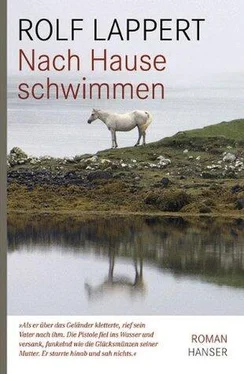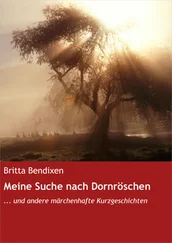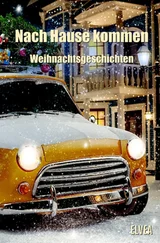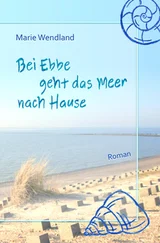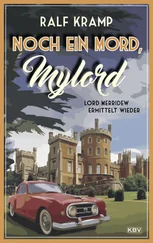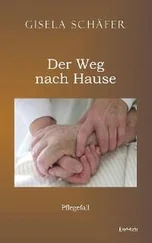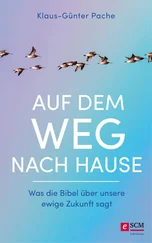Die beiden halten mich mit sanftem Druck fest, bis der Arzt den Raum betritt. Dass ich noch immer das Lasso in der Hand halte, bemerke ich erst, als er es mir wegnimmt. Ich sitze inzwischen auf dem Bett, flankiert von den beiden Pflegern, die sich ein wenig beruhigt haben. Der Arzt betrachtet den Bademantelgürtel, als überlege er, ob er meine paar Kilo getragen hätte. Dann sieht er mich an, und ich glaube Trauer in seinen Augen zu erkennen, Kummer. Tatsächlich seufzt er, bevor er redet.
«Es tut mir leid«, sagt er. Seine Stimme ist weich, sein Akzent vermag den Patienten die Angst zu nehmen, schlimme Dinge klingen harmloser, wenn sie aus seinem Mund kommen.
Ich bin kein Patient, denke ich, während Vermeer sich für die Sache mit dem Gürtel entschuldigt und dafür, dass ich wegen eines technischen Defekts für wenige Minuten nicht auf den Monitoren zu sehen war. Ich könnte ihm alles erklären. Das mit Little Joe und den Longhorns. Dass mir langweilig war, dass ich mich nicht erhängen wollte. Woran auch, vielleicht am Bettgestell, das in den Boden geschraubt ist? Oder an einer der Kameras, an die ich ohne Stuhl sowieso nicht rangekommen wäre und die so filigran wirken, als würden sie abbrechen unter dem Gewicht eines Kanarienvogels aus Burt Lancasters Zelle?
Als ich endlich den Mund aufmachen und alle Irrtümer mit ein paar wenigen klar formulierten Sätzen beseitigen will, als ich meine vorgetäuschte Stummheit beichten und meine sofortige Abreise anbieten will, höre ich den Arzt etwas sagen, das mich auch weiterhin schweigen lässt.
«… und deshalb werde ich Sie in die Offene Abteilung verlegen.«
Ich sehe ihn an. Er lächelt. Ich und die beiden Pfleger sitzen auf dem Bett wie Brüder, denen der Vater eine Geschichte erzählt hat. Dass ich nackt bin, hatte ich vergessen, und jetzt, da es mir bewusst wird, beginne ich zu weinen. Ich will nicht weinen, aber ich habe plötzlich Mitleid mit mir, weil außer mir alle bekleidet sind. Ich sehne mich nach einer Hose und einem Hemd und heule mit gesenktem Kopf und sehe dabei meinen Penis, der über der Innenseite des Oberschenkels liegt wie eine Eidechse in der Sonne. Vermeer streicht mir über den Kopf und verspricht, dass alles gut wird, und beinahe glaube ich ihm.
In der Offenen Abteilung ließe es sich wahrscheinlich leben, wenn da nicht all diese Typen wären. Diese Wanderer und Herumhocker und Leser und Spieler und Glotzer mit ihren vom Leben gebeutelten Köpfen, ihrem Murmeln und Schweigen und Quatschen. Sitzen herum und warten, schiefe Töne in einem öden Lied. Reisende ohne Ziel in einem Bahnhof, aus dem die Züge längst abgefahren sind. Einer trägt den Arm in der Schlinge, ein anderer zieht das Bein nach, in einem Sessel döst einer mit Halskrause. Ich wünschte, ich hätte dem Arzt zugehört und wüsste wenigstens, wo ich hier bin, Krankenhaus, Klapsmühle oder Erholungsheim.
Der Bau ist schön, die Innenarchitektur streng und edel. Wo man hinsieht, erstreckt sich Parkett, abgelöst von hellem Teppich. Sonnenlicht fällt durch Glasdächer, in die Wände sind Aquarien eingelassen, bunte Fische schweben darin. Pfleger schlendern umher, immer zu zweit, adrett gekleidete Collegeboys auf dem Campus. Über allem liegt Ruhe und Bedächtigkeit, ein großes Atemholen, aber die Anhäufung sonderbarer Männer macht mich nervös.
Nach dem Mittagessen hat Vermeer mich in das Zimmer geführt wie der Page den Hotelgast. Zuvor war ich eingekleidet worden, sandfarbene Socken, die Hose einen Ton dunkler, blaues T-Shirt und moosgrünes Hemd, weiße Turnschuhe ohne Markenname, alles wie angegossen. Vermeer erläuterte mir kurz das Prinzip der Offenen Abteilung und zeigte mir mein Bett, das Bad, den Schrank, das Regal mit den Büchern und den Heften von National Geographic und den Bildbänden über Tie re, das Sonnensystem und die Wunder der Erde.
Dann hat er mir Melvin vorgestellt, meinen Zimmergenossen. Melvin ist etwa Mitte fünfzig, eine Stirnbreit größer als ich und übergewichtig. Sein Händedruck ist warm und feucht, seine Stimme klar wie das Wasser in den Aquarien. Mich stellte Vermeer als Will vor. Den Namen hatte ich ihm nach langem Zögern auf seinen Block gekritzelt. Er hatte das wohl als großen Fortschritt betrachtet und mich gerührt und glücklich angestrahlt.
Danach führte er mich herum. Er zeigte mir den Fernsehraum, wo nur Filme über Tiere, das Sonnensystem und die Wunder der Erde laufen, vermutlich weil Nachrichtensendungen, Talkshows und Spielfilme eine verstörende Wirkung auf Menschen wie mich haben könnten. Wir sahen eine Weile drei Männern an einem Billardtisch zu und tranken grünen Tee, wobei ich meinen auslöffelte und Vermeer Anlass zu einer Notiz gab. Die Männer hatten ein eigenes, bescheuertes Spiel erfunden, bei dem leere Pappbecher, eine Untertasse und gestapelte Kekse wichtige Funktionen hatten.
Nach drei Partien von etwa zwei Minuten Länge, während derer die Männer die Kugeln von Hand über den Filz schoben, behutsam und mit der Konzentration von Uhrmachern, hatte ich keine Regeln ausmachen können, kein System, kein Muster. Ob es das Ziel des Spiels war, die Pappbecher umzustoßen, und ob es dabei eine Reihenfolge einzuhalten galt, blieb mir ein Rätsel. Warum die Männer zufrieden murmelten, wenn ihre Kugel wenige Zentimeter hinter einem Keksstapel zu liegen kam, aber aufstöhnten, wenn sie ihn berührte, erschloss sich mir nicht. Ob es galt, dem Unterteller einen Klang zu entlocken oder über möglichst viele Banden zu der leeren Zigarettenschachtel zurückzufinden, die in einer Ecke des Tisches vor dem Loch lag, war mir schleierhaft, und nichts war mir gleichgültiger. Trotzdem ließ ich die langsam rollende Kugel nicht aus den Augen, eingelullt von einem summenden Geräuschpegel, Vermeers melodischen Sätzen und den Medikamenten, die in meinem Körper schwappten.
Nachdem wir die leeren Teetassen in einen kleinen Fahrstuhl gestellt hatten, sind wir weitergegangen. Es gab noch Schach- und Damespieler, einen schalldichten Raum voller Instrumente und einen Erker mit großem Fenster, durch das man in einen Garten sah, wo ein paar Ziegen und ein vietnamesisches Hängebauchschwein grasten. Am Ende des Rundgangs brachte mich Vermeer zu meinem Zimmer zurück, unterhielt sich kurz mit Melvin und ging dann, nicht ohne mir einen schönen Aufenthalt zu wünschen.
Den hätte ich vielleicht sogar, wenn ich die Zimmertür zumachen, mich mit einem National Geographic aufs Bett legen und den Artikel über die Stämme auf Papua-Neuguinea lesen könnte, die sich gegenseitig töten, dabei jedoch, anders als die murmelnden Billardspieler, klaren Regeln folgen. Aber die Türen haben kein Schloss, und offenbar ist es in der Offenen Abteilung üblich, dass die Bewohner, Patienten, Insassen, was auch immer die offizielle Bezeichnung sein mag, sich untereinander besuchen. Glücklicherweise sind die meisten Männer hier nicht sehr kontaktfreudig, aber die paar, die einem längeren Monolog nicht abgeneigt sind, rauben mir schon nach wenigen Stunden den letzten Nerv.
Als erster kommt Stan, der sich ungefragt auf mein Bett setzt und von der Kunst des Rosenzüchtens schwärmt. Er trägt immer ein Buch bei sich, in das er Rosen gezeichnet hat, wissenschaftlich akribische Illustrationen, umgeben von Textwolken aus winzigen blauen Buchstaben, die Sorten, Namen, Herkunft und so weiter behandeln. Am liebsten redet Stan über das Düngen. Er preist die Vorteile einer Mixtur aus Eier- und Bananenschalen und Kaffeesatz, beschreibt die verblüffende Wirkung von Hühnermist und Pferdedung, und wenn er die Algen-, Asche- und Kalkmischung erwähnt, stottert er vor Aufregung. Stan riecht nach den Pfefferminzpastillen, die er dauernd lutscht, und sein Kopf, klein und gefleckt, erinnert an eine vom Sonnenlicht gesprenkelte Melone. Während er leise und deutlich spricht, bleibt sein Blick auf die Buchseiten geheftet, über die er mit den Fingern streicht. Bevor er geht, schenkt er mir ein Bonbon, klemmt das Buch unter den Arm und hat es plötzlich eilig wegzukommen.
Читать дальше