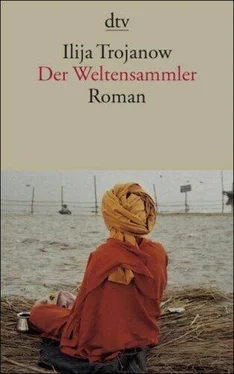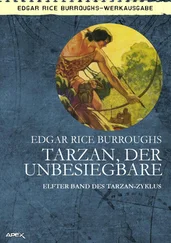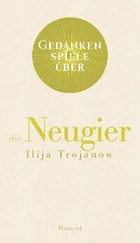41.
NAUKARAM
II Aum Amitaaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
— Ich habe sie gefunden. Das war ungerecht. Ich mußte ihre Hände zusammenlegen. Als ich Burton Saheb rufen ließ, hatte ich die häßlichsten Spuren schon entfernt. Er wollte sofort den alten Arzt rufen. Ich weiß nicht, wie oft ich ›Sie ist tot‹ wiederholen mußte, bis er es begriff. Er setzte sich an den Bettrand und stand stundenlang nicht mehr auf. Ich mußte die praktischen Dinge erledigen. Wer hätte sie sonst erledigt? Und das erwies sich als schwierig, wir hatten es nicht bedacht. Sie haben sich geweigert, sie zu verbrennen.
— Wer?
— Die Priester. Burton Saheb war fassungslos. So zornig, ich dachte, er würde die Verbrennung mit vorgehaltener Waffe erzwingen. Ich wollte ihm den Grund verschweigen, ich umging seine Fragen, er trieb mich in die Ecke, schließlich mußte ich ihm sagen, daß es eine Frage der Reinheit war. Ob sie wegen der Beziehung zu ihm als unrein gelte. Ja, sagte ich, auch deswegen.
— Sie haben eine Lösung gefunden?
— Ich traf einen Mann, in der Nähe der Verbrennungsstätte. Einer der Aussätzigen, die sich dort herumtrieben. Sein halbes Gesicht war weggefressen, sogar eine Hälfte seiner Zunge. Sein Anblick war nicht zu ertragen. Er redete mit einer Stimme, die bei lebendigem Leibe gehäutet wurde. Hast du dich verlaufen, Jungchen? Ich wollte davoneilen. Doch ich blieb stehen. Frag mich nicht, wieso. Ich erzählte ihm sogar von unserer Sorge. Wir werden euch helfen, sagte er. Bringt den Leichnam hierher, in der Nacht, wenn alle schlafen, und wir werden tun, was getan werden muß. Wir haben einen Pujari, wenn euch so was wichtig ist. Selbst seine Spucke ist heiliger als die Heuchler, die euch weggeschickt haben. Die verkriechen sich nachts, da müssen sie verspeisen, was sie tagsüber erbeutet haben. Nie habe ich Hilfe so ungern angenommen. Wir hatten keine andere Wahl. Es war ein guter Vorschlag, wenn auch mit drohender Stimme vorgetragen. Es hat lange gedauert, bis ich Burton Saheb überzeugt hatte. Bis er verstanden hatte, daß uns nichts anderes übrigblieb. Sein ganzer Einfluß und seine ganze Macht waren nutzlos. Ich wollte unter den Dienern nach Freiwilligen suchen, die uns helfen würden, ihre Leiche zum Fluß zu tragen. Er hielt mich zurück. Wir beide werden das tun, sagte er. Nur wir beide. Das ist unsere Pflicht. Wir wickelten sie in einige Tücher. Wir warteten, bis sich alle schlafen gelegt hatten. Ich öffnete die Tür des Bubukhanna und das Tor zur Straße, wir packten sie, ich an den Beinen, Burton Saheb am Kopf, und wir gingen los …
Der Lahiya schrieb alles mit, Zeile um Zeile füllte sich mit Naukarams Bericht, und zwischen den Zeilen flatterten seine Gedanken, entfernten sich von dieser faden Beschreibung. Sturm und Tod und Mitternacht und Verbrennungsstätte, was für eine Bühne, und dieser einfallslose Mensch beschrieb es wie ein Inventar. Wo waren die Nackten, die Schamlosen, die überquellende Töpfe mit Juwelen bewachen, vergraben von knorzigen Gierhälsen, denen der Geiz jegliche Angst geraubt hat? Wo war der Yogi, der mit zwei Schienbeinknochen auf einem Schädel grausige Festtagsmusik spielt? Der Lahiya hörte kaum noch zu, er konnte es nicht abwarten, sich zu verabschieden. Er eilte nach Hause, wischte den Gruß seiner Frau zur Seite, zog sich sofort in das zweite Zimmer zurück, in Sorge, auch nur eine einzige seiner vielen Ideen könnte sich verflüchtigen, bevor er sie niedergeschrieben hatte. Hastig notierte er das erste Bild, das ihm eingefallen war, zeichnete bisterfarbige Wolken, die über die Hochebene des Firmaments rollten, unförmig wie plumpe Ungeheuer. Und vor ihnen, im Mittelpunkt, zwei Männer, ein Herr und sein Diener, beide Fremde an diesem Ort, in dieser Nacht, beide miteinander verbunden auf mehr Wegen, als sie es wissen, als sie es sich eingestehen mögen. Sie schleppen schwer an einem Leichnam, an der verstorbenen Geliebten, ihrer Geliebten. Die Sichel des Mondes ist nicht heller als der Stoßzahn eines Elefanten, der aus einem Schlammloch steigt. Der Herr hievt den Leichnam über seine Schulter, er ist ein starker Mann, der selbst das Gewicht verflossener Liebe durch einen Sturm schleppen kann. Der andere, der Diener, sucht nach dem Pfad, mit unsicheren Schritten, als erwarte er, jeden Augenblick zu stolpern. Es beginnt zu regnen. Der Boden des Weges glimmert, ein schauriges Weiß. Ein ferner Lichtstrahl bricht durch alle Geflechte, wie ein Strich aus Gold, der über die dunkle Oberfläche eines Probiersteins ädert. Die beiden Männer folgen diesem Lichtstrahl, sei es, weil nichts anderes leuchtet, sei es, weil der Diener ahnt, daß es die einäschernden Feuer der Verbrennungsstätte sind, die so fragend die Nacht durchdringen. Sie erreichen die Smashaana, eine offene Fläche neben dem Fluß, ein Ort, der selbst tagsüber zu meiden ist. Verlassen, so scheint es den beiden Männern im ersten Augenblick, und der Diener wundert sich, ob er einem häßlichen Scherz aufgesessen ist. Doch der Gestank des Todes steigt aus der Erde. Der Diener bleibt zögerlich stehen. Wie würde er sich jemals von der Beschmutzung befreien können, nachdem er diesen unreinen Boden betreten hat? Der Herr hingegen, den die Unwissenheit schützt, geht weiter, die Leiche beschwert seinen Gang, er tritt auf liegengebliebene Knochen, ein Geräusch, so als würden die Zähne eines Ungeheuers knirschen. Der Diener zieht sich ein Ende seines Turbans über den Mund und folgt. Vor ihnen flackern die gespenstischen, düsterroten Flammen, als seien sie Schakale, die die kläglichen Überreste menschlichen Lebens verschlingen und abnagen bis auf die weißen Knochen. Über dem Feuer schweben flüchtige Gestalten, die zu prüfen haben, ob die Körper, von denen sie befreit worden sind, zu Asche verbrannt sind, in Wartestellung, bis der neue Körper, den sie bewohnen sollen, bereit ist, sie aufzunehmen. Es gibt auch jene, die in der Smashaana heimisch sind. Die Geister von heimtückisch Erschlagenen gehen umher mit blutenden Gliedern, gefolgt von den Skeletten ihrer Mörder, deren brüchige Knochen von einigen letzten Sehnen zusammengehalten werden. Derweil der Wind weiterjammert und der angeschwollene Fluß mit dem Blut aller Vergeblichen gurgelt. Die beiden Männer, die den Mut mehrerer Leben verbraucht haben, sind nicht allein. Am anderen Ende der Verbrennungsstätte sitzt eine Gruppe Elender zusammen, unter einer Plane, die vergeblich dem Wind und dem Regen trotzt. Mitten in der Gruppe sitzt der Mann mit dem halben Gesicht, neben ihm ein Stab, der fest im Boden steckt. Er ist gekleidet in einem ockerfarbenen Dhoti, sein Oberkörper nur von langen Haaren bedeckt, die in fettigen, verlausten Zöpfen herabfallen. Es ist das Haar eines Pferdes. Weiße Striche aus Kalk zäumen seinen Körper ein, und um die Hüfte trägt er ein Korsett aus Knochen. Wenn er sich nicht bewegt, ist er eine Statue. Er steht auf. Ihr seid da, sagt er. Es ist kein Willkommensgruß. Und das da wollt ihr loswerden. Sprich nicht so über sie, unterbricht ihn der Herr. Und der Diener wundert sich, ob er noch bei Verstand ist. Wir haben etwas Holz gehortet. Wir sind den Schattengewächsen zugetan, deswegen werden wir für die Verbrennung jener, die wir nicht kannten, die wir aber als eine von uns betrachten, Sandelholz beigeben. Ihr Abschied wird besser riechen als der Abschied eines Nagar Brahmanen. Der Herr legt den Leichnam auf den Boden. Nichts weiter wird von euch verlangt. Im Gegenteil, wir wollen, daß ihr verschwindet. Ihr seid unbrauchbar, es sei denn als Zeugen eures eigenen Albtraums.
42.
OHNE HINDERNISSE
— Ich war erstaunt, in der Bombay Times von letzter Woche zu lesen, was für Erfolge wir bei der Missionierung zu verzeichnen hätten.
— Angesichts der Umstände, Leutnant Awdry, stehen wir nicht schlecht da.
— Nicht schlecht? Na ja. Kann es noch schlechter bestellt sein?
Читать дальше