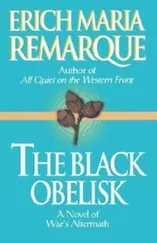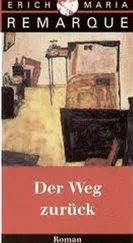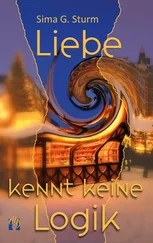Jemand klopfte. Draußen stand der Hausbursche mit zwei Paketen, Sie sah, daß in dem einen Blumen waren. Sie konnten nur von Clerfayt sein. Rasch gab sie dem Mann in dem schwachbeleuchteten Raum einen viel zu großen Schein. Im zweiten Paket war eine wollene Decke. »Ich glaube, Sie können sie brauchen«, schrieb Clerfayt. »Paris hat immer noch nicht genug Kohlen.« Sie faltete die Decke auseinander. Zwei kleine Kartons fielen heraus. Sie enthielten Glühbirnen. »Französische Hoteliers sparen immer an Licht«, schrieb Clerfayt dazu. »Ersetzen Sie Ihre Birnen mit diesen Lampen — sie machen die Welt sofort doppelt so hell.«
Sie folgte seinem Rat. Jetzt konnte sie wenigstens lesen. Der Hausknecht hatte eine Zeitung gebracht. Sie sah hinein, aber nach einer Weile legte sie sie beiseite. Das alles ging sie nichts mehr an. Ihre Zeit war zu kurz. Sie würde nie mehr wissen, wer im nächsten Jahre Präsident würde; ebenso nicht, welche Partei im Parlament regieren würde. Es interessierte sie auch nicht; sie war nur noch Wille zum Leben. Zu ihrem eigenen Leben.
Sie zog sich an. Sie hatte die letzte Adresse ihres Onkels; er hatte ihr vor einem halben Jahr von dort geschrieben. Sie wollte hinfahren und da weiter nach ihm forschen.
* * *
Sie hatte es nicht nötig. Der Onkel wohnte noch da; er hatte nur sein Telefon aufgegeben.
»Dein Geld?« sagte er. »Wie du willst. Ich habe es dir monatlich in die Schweiz geschickt, es war sehr schwierig, die Ausfuhrerlaubnis zu bekommen. Ich kann es dir natürlich monatlich in Frankreich auszahlen lassen. Wohin?«
»Ich will es nicht monatlich haben. Ich will alles jetzt sofort haben.«
»Wozu?«
»Ich will mir Kleider kaufen.«
Der alte Mann starrte sie an. »Du bist wie dein Vater Hätte er —«
»Er ist tot, Onkel Gaston.«
Gaston blickte auf seine blassen, großen Hände. »Du hast nicht mehr viel Geld. Was willst du hier anfangen? Mein Gott, wenn ich das Glück hätte, in der Schweiz leben zu können!«
»Ich habe nicht in der Schweiz gelebt. Ich habe in einem Krankenhaus gelebt.«
»Du weißt nicht, was Geld ist. Du wirst es in ein paar Wochen ausgeben. Du wirst es verlieren —«
»Möglich«, sagte Lillian.
Er sah sie erschreckt an. »Und wenn du es verloren hast, was dann?«
»Ich werde dir nicht zur Last fallen.«
»Du solltest heiraten. Bist du gesund?«
»Wäre ich sonst hier?«
»Dann solltest du heiraten.«
Lillian lachte. Es war zu durchsichtig; er wollte die Verantwortung für sie einem anderen zuschieben. »Du solltest heiraten«, wiederholte Gaston. »Ich könnte arrangieren, daß du einige Leute kennen lernst.«
Lillian lachte wieder; aber sie war neugierig, was der alte Mann anstellen würde. Er muß fast achtzig sein, dachte sie, aber er benimmt sich, als müsse er noch für weitere achtzig Jahre Vorsorgen. »Gut«, erwiderte sie. »Und nun sage mir noch eines: Was tust du, wenn du allein bist?«
Der Vogelkopf blickte verblüfft auf. »Irgend etwas — ich weiß nicht — ich beschäftige mich — sonderbare Frage! Warum?«
»Kommt dir nicht ab und zu der Gedanke, alles was du hast, zu nehmen und damit in die Welt zu gehen und es zu verschwenden?«
»Genau wie dein Vater!« erwiderte der alte Mann verächtlich. »Er hatte auch nie Sinn für Pflicht und Verantwortung! Ich sollte versuchen, dich unter Vormundschaft stellen zu lassen.«
»Das kannst du nicht. Du glaubst, ich werfe mein Geld weg — und ich denke, du wirfst dein Leben weg. Lass uns dabei bleiben. Und besorge mir das Geld bis morgen. Ich will die Kleider bald kaufen.«
»Wo?« fragte der Marabu schnell.
»Bei Balenciaga, denke ich. Vergiß nicht, daß das Geld mir gehört.«
»Deine Mutter —«
»Morgen«, sagte Lillian und küßte Gaston leicht auf die Stirn.
»Höre, Lillian, mach keinen Unsinn! Du bist sehr gut angezogen. Kleider in diesen Modehäusern kosten ein Vermögen!«
»Wahrscheinlich«, erwiderte Lillian und schaute über den dunklen Hof auf die grauen Fenster der gegenüberliegenden Häuserfront, die den letzten Rest des Abends spiegelten, als wären sie aus poliertem Schiefer.
»Wie dein Vater!« Der alte Mann war ehrlich entsetzt. »Genau so! Du könntest ohne Sorgen leben, hätte er nicht seine phantastischen Projekte —«
»Onkel Gaston, man hat mir gesagt, daß man sein Geld heute auf zwei Arten loswerden kann. Die eine, es zu sparen und es in der Inflation zu verlieren, und die andere, es auszugeben. Und nun sage mir noch, wie es dir geht.«
Gaston machte eine fahrige Bewegung. »Du siehst es ja. Es ist schwer heutzutage. Die Zeiten! Ich bin arm.«
Lillian sah sich um. Sie sah schöne, alte Möbel, Polstersessel, auf denen Bezüge lagen, einen Kristall-Lüster, der in Gaze eingebunden war, und einige gute Bilder.
»Du warst immer geizig, Onkel Gaston«, sagte sie. »Warum bist du es jetzt noch?«
Er musterte sie aus dunklen Vogelaugen. »Willst du hier wohnen? Ich habe wenig Platz —«
»Du hast genug Platz, aber ich will nicht hier wohnen. Wie alt bist du eigentlich? Warst du nicht zwanzig Jahre älter als mein Vater?«
Der alte Mann war irritiert. »Wenn du es weißt, wozu fragst du mich dann noch?«
»Hast du keine Angst vor dem Tode?«
Gaston schwieg einen Augenblick. »Du hast abscheuliche Manieren«, sagte er dann leise.
»Das ist wahr. Ich hätte dich nicht fragen sollen. Aber ich frage mich das so oft, daß ich vergesse, daß es andere erschreckt.«
»Ich bin noch gut beieinander. Solltest du mit einer baldigen Erbschaft rechnen, so könnte es eine Enttäuschung sein.«
Lillian lachte. »Damit rechne ich bestimmt nicht! Und ich wohne in einem Hotel und werde dir hier nicht zur Last fallen.«
»In welchem Hotel?« fragte Gaston rasch.
»Im Bisson.«
»Gottlob. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn du ins Ritz gezogen wärest.«
»Ich mich auch nicht«, sagte Lillian.
* * *
Clerfayt holte sie ab. Sie fuhren in das Restaurant Le Grand Véfour. »Wie war Ihr erster Zusammenstoß mit der Welt hier unten?« fragte er.
»Ich habe das Gefühl, unter Menschen zu sein, die glauben, daß sie ewig leben. So handeln sie wenigstens. Sie verteidigen ihren Besitz und versäumen darüber ihr Leben.«
Clerfayt lachte. »Dabei haben alle sich im letzten Krieg geschworen, nie mehr denselben Fehler zu machen, wenn sie lebend durchkämen. Der Mensch ist groß im Vergessen.«
»Hast du es auch vergessen?« fragte Lillian.
»Ich habe mir große Mühe gegeben. Es ist mir hoffentlich nicht ganz gelungen.«
»Liebe ich dich deshalb?«
»Du liebst mich nicht. Wenn du mich liebtest, würdest du das Wort nicht so leichtfertig gebrauchen — und es mir nicht sagen.«
»Liebe ich dich, weil du nicht an die Zukunft denkst?«
»Dann hättest du jeden Mann im Sanatorium lieben müssen. Wir werden hier Seezunge mit gerösteten Mandeln essen und einen jungen Montrachet dazu trinken.«
»Weshalb liebe ich dich dann?«
»Weil ich gerade da bin. Und weil du das Leben liebst. Ich bin für dich ein anonymes Stück Leben. Höchst gefährlich.«
»Für mich?«
»Für den, der anonym ist. Er kann beliebig ersetzt werden.«
»Ich auch«, sagte Lillian. »Ich auch, Clerfayt.«
»Dessen bin ich nicht mehr so ganz sicher. Wenn ich klug wäre, würde ich so bald wie möglich ausreißen.«
»Du bist doch noch gar nicht richtig da.«
»Ich fahre morgen weg.«
»Wohin?« fragte Lillian, ohne es zu glauben.
»Weit weg. Ich muß nach Rom.«
»Und ich zu Balenciaga, Kleider kaufen. Das ist noch weiter als Rom.«
»Ich fahre wirklich. Ich muß mich um einen Vertrag kümmern.«
»Gut«, sagte Lillian. »Das gibt mir Zeit, mich in das Abenteuer der Modehäuser zu stürzen. Mein Onkel Gaston möchte mich bereits unter Kuratel stellen — oder mich verheiraten.«
Читать дальше