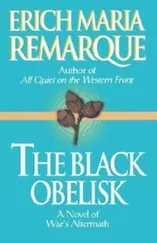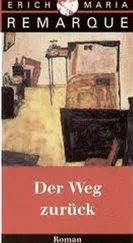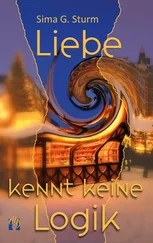Lillian antwortete nicht; die Ironie war zu stark.
»Ich habe mit der Oberschwester gesprochen«, erklärte der Dalai Lama, der ihr Schweigen als Schreck auffasste. »Sie hat mir gesagt, daß es nicht das erste Mal war. Sie hat Sie schon öfter gewarnt. Sie haben es nicht beachtet. So etwas zerstört die Moral des Sanatoriums. Wir können es nicht dulden, daß —«
»Ich sehe das ein«, unterbrach Lillian ihn. »Ich werde das Sanatorium heute nachmittag verlassen.«
Der Dalai Lama blickte sie überrascht an. »So eilig ist es nicht«, erwiderte er dann. »Nehmen Sie sich Zeit, bis Sie einen Platz gefunden haben. Oder haben Sie das schon getan?«
»Nein.«
Der Professor war etwas aus dem Text gebracht. Er hatte Tränen und die Bitte, es noch einmal zu versuchen, erwartet. »Weshalb arbeiten Sie so gegen Ihre Gesundheit, Fräulein Dunkerque?« fragte er schließlich.
»Als ich alles tat, was vorgeschrieben wurde, ist es auch nicht besser geworden.«
»Aber das ist doch kein Grund, es nicht mehr zu tun, wenn es einmal schlechter wird«, rief der Professor ärgerlich. »Im Gegenteil. Dann ist man doch besonders vorsichtig!«
Wenn es einmal schlechter wird, dachte Lillian. Es traf sie nicht so wie gestern, als die Schwester es ihr zugegeben hatte. »Selbstzerstörerischer Unsinn!« polterte der Dalai Lama weiter, der glaubte, ein goldenes Herz unter einer rauen Schale zu haben. »Fegen Sie diesen Unsinn aus Ihrem hübschen Kopf heraus!«
Er faßte sie an die Schulter und schüttelte sie leicht. »Na, nun gehen Sie in Ihr Zimmer, und beachten Sie von jetzt an die Vorschriften genau.«
Lillian glitt mit einer Bewegung ihrer Schulter unter seiner Hand weg. »Ich würde die Vorschriften auch weiter verletzen«, sagte sie ruhig. »Deshalb halte ich es für besser, das Sanatorium zu verlassen.«
Das, was der Dalai Lama ihr über ihren Zustand gesagt hatte, hatte sie nicht nur nicht erschreckt, sondern sie im Gegenteil plötzlich sicher und kühl gemacht. Es verminderte sonderbarerweise auch den Schmerz um Boris, da die Freiheit der Wahl auf einmal von ihr genommen zu sein schien. Sie fühlte sich wie ein Soldat, der nach langem Warten einen Marschbefehl erhalten hat. Es war nichts mehr zu tun als ihm zu folgen. Das Neue hatte bereits Besitz von ihr genommen, so wie beim Soldaten der Marschbefehl bereits Teil der Uniform und des Kampfes — und vielleicht auch des Endes war.
»Machen Sie keine Schwierigkeiten«, polterte der Dalai Lama. »Hier gibt es doch kaum ein anderes Sanatorium — wo wollen Sie denn schon hin? In eine Pension?«
Er stand da, der große, gutmütige Gott des Sanatoriums, und wurde ungeduldig, weil diese widerspenstige Katze ihn bei seinem Wort nahm mit der Entlassung, um ihn zu zwingen, wie er glaubte, sie zurückzunehmen. »Die paar Regeln sind doch nur in Ihrem Interesse«, rumpelte es. »Wo kämen wir hin, wenn hier Anarchie herrschte. Und sonst? Wir sind doch wirklich hier kein Gefängnis. Oder finden Sie?«
Lillian lächelte. »Nicht mehr«, sagte sie. »Und ich bin kein Patient mehr. Sie können wieder zu mir sprechen wie zu einer Frau. Nicht mehr wie zu einem Kinde oder einem Sträfling.«
Sie sah noch, wie der Dalai Lama erneut rosig anlief. Dann war sie draußen.
Sie packte ihre Koffer fertig. Heute abend, dachte sie, werde ich die Berge verlassen haben. Zum ersten Male in Jahren spürte sie eine Erwartung, hinter der eine Erfüllung stand — nicht mehr die Erwartung einer Fata Morgana, die Jahre weit entfernt war und immer wieder zurückrückte, sondern die der nächsten Stunden. Vergangenheit und Zukunft hingen in einer zitternden Balance, und das erste, was sie fühlte, war nicht Alleinsein, sondern eine gespannte, hohe Einsamkeit. Sie nahm nichts mit, und sie wußte nicht, wohin sie ging.
Sie fürchtete sich davor, daß Wolkow noch einmal käme, und sie sehnte sich danach, ihn noch einmal zu sehen. Sie schloß ihre Koffer, und ihre Augen waren blind vor Tränen. Sie wartete, bis sie wieder ruhig geworden war. Sie bezahlte ihre Rechnung und schlug zwei Angriffe des Krokodils ab — den letzten im Namen des Dalai Lama. Sie verabschiedete sich von Dolores Palmer, Maria Savini und Charles Ney, die sie anstarrten, wie die Japaner im Kriege ihre Selbstmordflieger angesehen haben mochten. Sie ging in ihr Zimmer zurück und wartete. Dann hörte sie ein Kratzen und Bellen vor der Tür. Sie öffnete, und der Schäferhund Wolkows kam herein. Das Tier liebte sie und war oft allein zu ihr gekommen. Sie glaubte, Boris habe es geschickt und werde selbst auch noch kommen. Aber er kam nicht. Dafür erschien die Zimmerschwester und erzählte ihr, die Angehörigen Manuelas würden die Tote in einem Zinksarg nach Bogotб schicken.
»Wann?« fragte Lillian, um etwas zu fragen.
»Heute noch. Sie wollen so rasch wie möglich reisen. Draußen steht schon der Schlitten. Sonst wartet man doch immer bis nachts; aber der Sarg soll noch ein Schiff erreichen. Die Angehörigen reisen mit dem Flugzeug.«
»Ich muß jetzt gehen«, murmelte Lillian. Sie hatte den Wagen Clerfayts gehört. »Leben Sie wohl.«
Sie schloß die Tür hinter sich und ging den weißen Korridor entlang wie ein Dieb auf der Flucht. Sie hoffte, unbemerkt durch die Halle zu kommen, aber das Krokodil wartete neben dem Aufzug.
»Der Professor läßt Ihnen noch einmal sagen, daß Sie hier bleiben können. Und hier bleiben sollten.«
»Danke«, sagte Lillian und ging weiter.
»Seien Sie doch vernünftig, Miss Dunkerque! Sie kennen Ihre Situation nicht. Sie dürfen jetzt nicht nach unten. Sie würden das Jahr nicht überleben.«
»Gerade deshalb.«
Lillian ging weiter. An den Bridgetischen hoben sich ein paar Köpfe; sonst war die Halle leer. Die Patienten hatten Liegekur. Boris war nicht da. Hollmann stand am Ausgang.
»Wenn Sie absolut fahren wollen, dann nehmen Sie wenigstens die Eisenbahn«, sagte das Krokodil.
Lillian zeigte der Oberschwester stumm ihren Pelz und ihre Wollsachen. Das Krokodil machte eine verächtliche Bewegung. »Das nützt nichts! Wollen Sie mit Gewalt Selbstmord begehen?«
»Das tun wir alle — der eine schneller, der andere langsamer. Wir fahren vorsichtig. Und nicht weit.«
Die Ausgangstür war jetzt ganz nahe. Die Sonne blendete von draußen herein. Noch ein paar Schritte, dachte Lillian, und das Spießrutenlaufen ist zu Ende. Noch einen Schritt! »Sie sind gewarnt worden«, sagte die gleichmäßige, kalte Stimme neben ihr. »Wir waschen unsere Hände in Unschuld!«
Es war ihr nicht danach zumute, aber Lillian mußte lächeln. Das Krokodil hatte mit einem letzten Klischee die Situation gerettet. »Waschen Sie sie in sterilisierter Unschuld«, sagte Lillian. »Adieu! Danke für alles.«
Sie war draußen. Der Schnee reflektierte das Licht so stark, daß sie kaum sehen konnte. »Auf Wiedersehen, Hollmann!«
»Auf Wiedersehn, Lillian. Ich komme bald nach.«
Sie blickte auf. Er lachte. Gott sei Dank, dachte sie, endlich kein Schulmeister. Hollmann packte sie in ihre Wollsachen und ihren Pelz. »Wir werden langsam fahren«, sagte Clerfayt. »Wenn die Sonne untergeht, machen wir das Verdeck zu. Jetzt schützen die Seitenteile Sie gegen den Wind.«
»Ja«, erwiderte sie. »Können wir abfahren?«
»Haben Sie nichts vergessen?«
»Nein.«
»Wenn doch, dann kann man es nachschicken lassen.«
Daran hatte sie nicht gedacht. Es tröstete sie plötzlich. Sie hatte geglaubt, alle Verbindungen würden abgerissen sein, wenn sie abführe. »Ja, wirklich, man kann es sich nachschicken lassen«, sagte sie.
Ein kleiner Mann, der wie eine Kreuzung zwischen einem Kellner und einem Küster aussah, kam rasch über den Platz. Clerfayt stutzte. »Das ist doch —«
Der Mann ging zum Eingang, dicht am Wagen vorbei, und Clerfayt erkannte ihn jetzt. Er trug einen dunklen Anzug, einen schwarzen Hut und einen Reisekoffer. Es war der Leichenbegleiter; er war wie verwandelt — nicht mehr zerknittert und mürrisch, sondern fröhlich und autoritativ. Er war auf dem Wege nach Bogotб.
Читать дальше