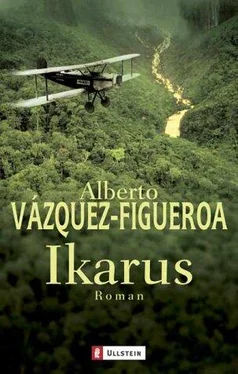Ein letztes Mal wurde beratschlagt, dann schienen die Indianer eine Entscheidung getroffen zu haben, denn jetzt teilten sich die Krieger blitzschnell in zwei Gruppen auf.
Die einen verschwanden im nahe gelegenen Wald, aus dem man bald laute Machetenhiebe hörte.
Die anderen eilten zur Felswand und untersuchten sie mit größter Aufmerksamkeit.
»Es sind guaharibos !«, rief Delgado mit erstickter Stimme. »Dem Himmel sei Dank! Es sind tatsächlich guaharibos !«
»Woher weißt du das?«
»Weder waicas, pemones noch sonst ein Stamm würde sich erst die Mühe machen, eine Stelle zu suchen, an der sie hochklettern könnten. Weil sie nämlich gar nicht wüssten, wie!«
Sie warteten.
Aus Minuten wurden Stunden, aus Stunden fast ein Leben.
Schließlich hörten sie, wie ein Indianer, etwa hundert Meter von dem Schacht entfernt, wo sie ausharrten, die anderen herbeirief, die ohne Eile zu ihm traten.
Der Krieger deutete auf die Felswand und machte eine kreisförmige Bewegung mit dem Arm.
Dann hockte sich die Gruppe erneut hin und musterte den Berg, während sie auf die anderen Indianer wartete, die im Wald verschwunden waren. Es dauerte eine Weile, bis diese mit spitzen, etwa fünfzig Zentimeter langen Pfählen aus dem Wald wieder auftauchten.
»Da sind sie!«, rief Delgado, der sich weit über den Abhang gebeugt hatte, ohne darauf zu achten, dass er jeden Moment abstürzen konnte. »Da sind sie. Sie werden es versuchen! Großer Gott! Sie wollen tatsächlich versuchen, uns zu retten!«
Die guaharibos hatten in der Tat beschlossen, einen Versuch zu wagen, doch sie ließen sich viel Zeit.
Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis alle darin übereinstimmten, dass die ausgesuchte Stelle tatsächlich geeignet war, um den Berg zu besteigen. Erst dann begannen sie, mit Hilfe einer schweren Keule den ersten Pfahl in den Felsen zu schlagen.
Etwa einen Meter über dem Boden hämmerten sie den gespitzten Pfahl so lange in einen Spalt, bis nur noch dreißig Zentimeter herausragten.
Zwei Indianer hängten sich daran, um seine Festigkeit zu prüfen, und brachten den zweiten Pfahl etwa einen Meter über dem ersten an.
Der wurde nicht genau über dem ersten in den Felsen geschlagen, sondern etwa einen Meter weiter nach rechts versetzt.
Anschließend kletterte ein junger Krieger auf den ersten Pfahl, stützte sich am zweiten ab und hämmerte im gleichen Abstand wie die vorherigen den dritten in den Stein.
»Was zum Teufel machen die da?«, fragte der König der Lüfte, der von seinem Platz aus nicht sehen konnte, was unten vor sich ging.
»Sie bauen eine Treppe«, klärte ihn Delgado auf. »Sie suchen im Felsen nach Spalten, in die sie ihre Pfähle hämmern können. So arbeiten sie sich langsam hoch. Sie sind verdammt geschickt!«
Tatsächlich waren sie verdammt geschickt, vor allem aber gelenkig und waghalsig, auch wenn sie Außenstehenden zuweilen den Eindruck vermittelten, ihre Bewegungen seien tausendfach geübt.
Als der Krieger an der Spitze vier Pfähle in den Felsen geschlagen hatte, stieg er hinunter und übergab die Keule einem anderen, der im Handumdrehen hinaufkletterte, als steige er eine bequeme Treppe hoch, und die Arbeit fortsetzte.
Er stemmte sich mit beiden Füßen auf den vorletzten Pfahl und stützte sich mit der Brust am obersten ab, sodass er keinerlei Risiko einging, als er anschließend mit der linken Hand den neuen Pfahl ansetzte und ihn dann mit der Keule, die er am rechten Handgelenk befestigt hatte, in den Felsen trieb.
Wenn eine Spalte aus irgendeinem Grund nicht genügend Halt für den Pfahl bot, wurde ein »Spezialist« hinzugezogen. Mit Hilfe eines stählernen Meißels und eines schweren Hammers schlug dieser zuerst ein Loch in das harte Gestein. Er arbeitete mit einer solchen Präzision, dass anschließend keiner mehr den einmal eingeführten Pfahl hätte wieder herausziehen können.
Halb Menschen, halb Affen, halb Bergziegen, halb Eichhörnchen, turnten die guaharibos an der Felswand herum, als hätte eine höhere Instanz das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben und als wäre Höhenangst bloß eine dumme Erfindung der Weißen.
Tausende von Jahren hatten die guaharibos tief in den Bergen des unzugänglichen Escudo Guayanés überlebt. Ihre einzige Verteidigung gegen die zahlenmäßige Überlegenheit ihrer grausamen Feinde war die Fähigkeit gewesen, in die höchsten Berge zu flüchten, wo niemand wagen würde, sie zu verfolgen. Offensichtlich hatten sie einen angeborenen Instinkt entwickelt, wenn es darum ging, sich in großen Höhen zu bewegen. Eine achtzig Meter hohe Steilwand wäre für jeden anderen ein unüberwindbares Hindernis gewesen, für sie aber schien es eher ein Zeitvertreib zu sein.
Trotz der anstrengenden Arbeit sangen und lachten sie. Die Scherze galten offensichtlich den vier Weißen, die wie verschreckte Hühner auf ihrem Felsvorsprung hockten. Sie waren so unbeschwert, dass sie alles stehen und liegen ließen, als zwei ihrer Mitglieder mit einem fetten Tapir, den sie an einen Stock gebunden über die Schulter trugen, aus dem dichten Wald kamen.
»Nicht zu fassen!«, sagte Jimmie verdutzt. »Die haben tatsächlich vor, erst einmal ein Festmahl abzuhalten, während wir hier oben schmoren.«
»Wenn es nur das wäre«, erklärte Delgado. »Nach dem Festmahl werden sie erst mal ein Mittagsschläfchen halten.«
»Du machst wohl Witze?«
»Lass dich überraschen.«
»Können wir denn nichts dagegen unternehmen?«
»Was denn? Sie erweisen uns einen großen Dienst. Wir können nur beten, dass sie nicht müde werden. Guaharibos sind sehr primitive Menschen und mehr als eigensinnig. Sie arbeiten nur, wenn es ihnen Spaß macht, aber wenn sie plötzlich keine Lust mehr haben oder sich dabei langweilen, lassen sie alles liegen und ziehen weiter. Daher auch ihr Spitzname, Langbeine. Sie halten es nirgendwo sehr lange aus.«
»Komisch«, sagte Mary und zeigte nach unten. »Sie haben die Sachen, die wir hinuntergeworfen haben, nicht mal angefasst und machen einen großen Bogen darum, als würden sie jeden Kontakt meiden.«
»Das tun sie auch«, erklärte Henry. »Sie rühren nie etwas an, das von uns Weißen stammt, außer Gegenstände aus Metall. Sie haben eine Todesangst vor Krankheiten.«
»Krankheiten?«, wiederholte sie überrascht.
»Ja, Grippe, Masern, Tuberkulose… All diese Krankheiten sind für sie tödlich, weil sie keine Abwehrkörper dagegen besitzen. Sie haben mit der Zeit gelernt, dass wir Weißen sie auf direktem Weg oder über unsere Kleidung übertragen, deshalb lassen sie es nicht zu, dass wir ihnen nah kommen. Wenn sie Tauschhandel betreiben, dann nur aus sicherem Abstand. Ohnehin nehmen sie nur Töpfe, Nägel, Hämmer oder Macheten an.«
»Merkwürdig.«
»Sie sind zwar primitiv, aber nicht dumm. Nur so haben sie es geschafft zu überleben, auch wenn ihre Zahl sehr gering ist.«
Ein Knurren unterbrach ihn.
Es klang laut und trocken und kam aus seinen tiefsten Eingeweiden, als ihnen der Duft des saftigen Bratens in die Nase stieg. Drei Tage waren vergangen, seit sie zum letzten Mal etwas gegessen hatten.
Seit das Auftauchen der Indianer in ihnen wieder die Hoffnung auf Rettung geweckt hatte, waren auch der Hunger und die Lebenslust zurückgekehrt. Jetzt verlangten ihre ausgelaugten Körper wieder die Aufmerksamkeit, die ihnen die ganze Zeit verwehrt worden war.
Doch sie mussten sich mit dem Duft begnügen und sogen ihn tief ein. Resigniert sahen sie zu, wie die Wilden ihre Mahlzeit beendeten und sich anschließend zu einem Mittagsschläfchen hinlegten. Laut schnarchend warteten sie, dass die heißesten Stunden des Tages vergingen.
Ihnen dagegen verbrannte die sengende Sonne die milchweiße Haut. In ihrer Nacktheit fühlten sie sich erbärmlicher und verletzlicher als je zuvor.
Читать дальше