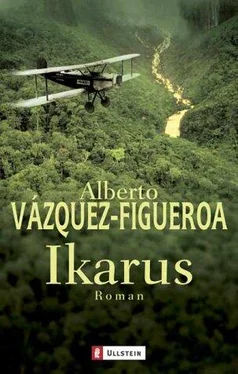Die Schatten über der Gran Sabana wurden allmählich länger. Direkt vor ihren Augen versank die Sonne gemächlich hinter den Bergen. Sie beschlossen, das Nachtlager zu errichten, schlugen die vom vielen Gebrauch bereits verbogenen Kletterhaken in den Felsen und seilten sich daran fest.
Auf engstem Raum an die Felswand gebunden schliefen sie wie in einer Zwangsjacke. Sie wussten, dass sie sich nicht bewegen durften, wollten sie die anderen nicht unnötig gefährden. Und obwohl sie unter dem sternenfunkelnden Himmel im Freien schliefen, hatte jeder Einzelne von ihnen das Gefühl einer klaustrophobischen Enge.
Trotzdem war ihre Lage um vieles angenehmer als in der Nacht zuvor. Im Morgengrauen fiel ein Schauer, der im Nu in einen tropischen Platzregen überging. Vom Gipfel des Berges prasselte ein wahrer Wasserfall auf sie nieder, der sie zwar vom beißenden Geruch nach Schweiß und Fäkalien befreite und ihren Durst stillte, sie aber auch in die Tiefe zu reißen drohte.
»Verdammt noch mal!«, schrie Jimmie außer sich vor Wut. »Wer hat es bloß auf uns abgesehen?«
»Wahrscheinlich der Teufel in dem Berg«, antwortete Henry scherzhaft und versuchte, die Ruhe zu bewahren, obwohl er mit Sorge beobachtete, wie sich die Kletterhaken im Felsen unter der Wucht des Wassers allmählich lockerten. »Wir haben ihn geärgert und jetzt ärgert er uns.«
»Die Regenzeit in der Gran Sabana ist doch längst vorbei!«, sagte Mary verzweifelt.
»Ich habe fast mein ganzes Leben in der Gran Sabana verbracht und das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass sie macht, was sie will«, mischte sich Delgado ein, der seine Einsilbigkeit verloren zu haben schien. »Entweder akzeptiert man es so oder man bleibt ihr fern.«
Reglos verharrten sie, wo sie waren, und trotzten den Unmengen an Wasser, das von Süden kam, gegen die hohe Felswand peitschte und dann an ihr herabrauschte. Man hätte fast meinen können, dass der Himmel nur darauf aus war, sie bis auf die Knochen zu durchnässen. Als endlich die ersten Sonnenstrahlen am Horizont auftauchten, zitterten sie vor Kälte wie Espenlaub.
Eine wattige Masse hatte sich über die Landschaft gelegt. Reglos saßen sie im Dunst und starrten gedankenverloren in die Leere. So abwesend, dass man den Eindruck haben konnte, sie wären schon tot und warteten nur noch auf das Jüngste Gericht.
Kein Mensch auf der Welt war sich je so einsam und verloren vorgekommen wie diese Unglücksraben auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde.
Niemand hatte sich je so tot gefühlt und doch so am Leben gehangen.
Niemand war so mutig und zugleich verzagt gewesen.
Man kann ziellos durch den Dschungel oder die Wüste irren, im menschenfeindlichen Gebirge die Orientierung verlieren, sich im Dunkeln durch tiefe Höhlen und Tunnel tasten.
Aber dass diese drei Männer und eine Frau verwirrt an einer schwarzen Felswand herumkraxelten, mal nach oben, dann wieder nach unten, mal vor, dann wieder zurück, mal schweigend, mal fluchend, erschien einfach absurd. Als hätten sie nicht eine herrliche Landschaft mit endlosen Horizonten vor sich, sondern wären von tiefster Finsternis umgeben.
Ihre Bezugspunkte waren immer gleich. Der Fluss und das Lager. Ihr Ziel war klar: die Füße wieder auf festen Boden zu setzen. Und doch lebten sie in ständiger Angst, dass ein falscher Schritt der letzte sein konnte.
Es kam ihnen vor, als wären sie in ein vertikales Labyrinth geraten.
Den vierten Tag verbrachten sie in einer geräumigen drei Meter tiefen Höhle, die ihnen wie ein Märchenschloss vorkam. Dort gönnten sie ihren geschundenen Körpern, die allmählich gegen die Strapazen rebellierten, eine Verschnaufpause, bevor sie sich wieder den Schrecken der Höhe stellten.
Am nächsten Morgen beschlossen die beiden Bergsteiger, allein loszuziehen, um einen Weg zu finden. Mary und Jimmie Angel kauerten eng umschlungen am Ende der Höhle und dachten an die Möglichkeit, dass die beiden den weisen Entschluss gefasst haben könnten, wenigstens ihre eigene Haut zu retten.
»Es sind gute Jungs«, sagte Mary kaum hörbar, als hätte sie die Gedanken ihres Mannes erraten. »Gute und starke junge Männer, die es verdienen, am Leben zu bleiben.«
»Du bist auch gut, stark und jung«, gab ihr Mann zurück. »Du hättest es genauso verdient.«
»Ich bin am Ende. Es würde mir nichts ausmachen, Hand in Hand mit dir in den Abgrund zu springen.« Sie sagte das vollkommen ernst.
»Wir sollten nichts überstürzen«, erwiderte Jimmie. »Diese Möglichkeit läuft uns ja nicht davon. Nun bin ich schon so lange Flieger, aber ich habe immer noch nicht gelernt, es ohne Flügel zu versuchen. Ich Esel! Warum habe ich mich bloß immer geweigert, einen Fallschirm mit an Bord zu führen? Nur weil ich ständig damit angeben musste, dass ich überall landen kann! Jetzt wäre ein Fallschirm Gold wert.«
»Hättest du es fertig gebracht, vom Gipfel des Tepui abzuspringen?«, fragte sie ungläubig.
»Na klar. Du etwa nicht?«
»Ich glaube nicht.«
»Findest du das hier etwa besser?«
»Ich weiß es nicht mehr«, gestand Mary aufrichtig. »Ich fühle mich wie unter Drogen. Als wäre ich gar nicht mehr ich selbst. Als lebte ich in einem Albtraum, aus dem ich nie erwachen werde. Wenn ich mir vorstelle, dass uns nur fünfhundert Meter vom Leben trennen, dass sie aber auch den Tod bedeuten können, habe ich ein solches Gefühl von Ohnmacht, dass ich schreien könnte.«
»Ich weiß, dass du das nicht tun wirst.«
»Da bin ich nicht sicher.«
Schweigend umarmten sie sich, wie kleine Kinder, die sich im dunklen Wald verirrt haben und nun sehnsüchtig auf die Rückkehr ihrer Kameraden hoffen. Gleichzeitig fürchteten sie sich aber auch davor, denn dann wären sie gezwungen, den mörderischen Abstieg fortzusetzen.
Dann kehrten die beiden Bergsteiger tatsächlich zurück, wie sie versprochen hatten.
Wie immer.
Eine gute Nachricht aber brachten sie nicht mit.
Die Verzweiflung wurde übermächtig.
Ihr Labyrinth hatte keinen Ausgang.
Der einzige Ausweg war dieser eine falsche Schritt.
Am neunten Tag waren sie fast verhungert, zerlumpt und völlig erschöpft. Jeder Zentimeter ihrer Haut war übersät mit blutigen Schürfwunden. Sie hatten kaum noch Kraft, um sich an der Bergwand festzuhalten. Ihre entzündeten Augen waren von der Sonne versengt und in den mit Blasen und eitrigen Wunden bedeckten Gesichtern kaum noch zu erkennen. Schließlich gelangten sie zu einem Hang, der achtzig Meter steil herabfiel.
Hier waren sie am Ende aller Wege angelangt.
Ihre zerfetzten Seile hätten nicht mal mehr das Gewicht eines Säuglings ausgehalten. Sämtliche Kletterhaken waren abgebrochen. Sie hatten keine einzige Dattel mehr und kaum noch Trinkwasser. Doch das Schlimmste war, dass sie den Glauben an sich selbst verloren hatten.
Wie so viele vor ihnen sollten auch sie im letzten Augenblick scheitern.
Cardona schrie ihnen von unten Mut zu und versuchte, sie anzuspornen. Doch Henry wusste, dass seine Hände ihm nicht mehr gehorchten. Die Finger, früher stark wie die Krallen eines Raubtiers, waren nur noch rohes Fleisch. Die Hälfte seiner Nägel war abgerissen. Die Augen, normalerweise scharf wie die eines Adlers, waren verschleiert von eitrigen Entzündungen auf seinen Lidern.
Nach sechs Stunden, die sie wie zerbrochene Puppen einfach nur da gesessen hatten, verstummte Cardonas heisere Stimme schließlich. Plötzlich wurde es vollkommen still, als warteten sie auf die Ankunft des Todes oder darauf, dass einer nach dem anderen in ’den Abgrund stürzte. In diesem Augenblick wurde Jimmie klar, dass er das Kommando wieder an sich reißen musste. Die beiden Bergsteiger hatten alles Menschenmögliche getan — viel mehr, als man hätte erwarten können.
Die Verantwortung und die Last des Abstiegs hatten einzig und allein auf ihren Schultern gelegen. Sie hatten übermenschliche Anstrengungen auf sich genommen. Nun aber schien es völlig zwecklos und obendrein ungerecht, ihnen weiterhin die Last der Entscheidungen aufzubürden.
Читать дальше