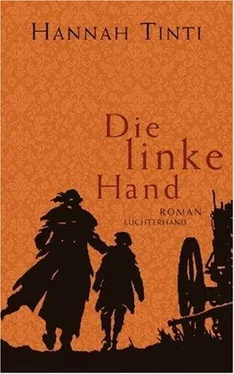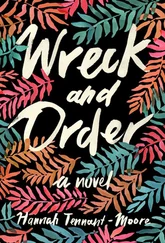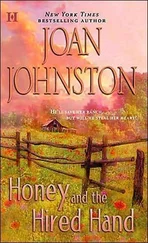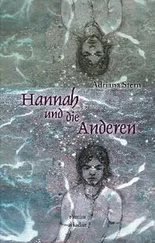Es hatte einige Zeit gedauert, bis Benjamin seine Meinung über Bowers’ Angebot geändert hatte. Ren hatte die beiden Männer nachts miteinander flüstern hören. Tom drängte darauf, dass sie den Auftrag annahmen, aber Benjamin sagte nur, nach North Umbrage würde er nie mehr zurückkehren. Und dann eines Nachmittags, als Tom die Windpocken beinahe überstanden hatte und sich die letzten Schorfplättchen von der Haut schälten, hatte der Schullehrer im Keller eine Flasche Whiskey aufgemacht und Ren gefragt, was er einmal werden wolle, wenn er erwachsen sei.
»Ich weiß es nicht«, sagte Ren und blickte von seinem Buch auf.
»Hast du nie darüber nachgedacht? Nicht ein einziges Mal?«, fragte Tom. »Wie wär’s mit Fischer, wie die Burschen, die du in der Schenke kennengelernt hast.«
Benjamin putzte am Tisch seine Stiefel. Er schmierte einen Streifen schwarze Wichse auf die Schuhkappe und verrieb sie. »Lass ihn in Frieden.«
»Findest du nicht, dass das kleine Ungeheuer einen Beruf braucht?« Tom trank noch einen Schluck Whiskey. »Vielleicht will er den Rest seines Lebens ja nicht in einem Keller zubringen.«
»Wir werden diese Art von Arbeit nicht ewig machen.«
»Das sagst du jedes Mal«, sagte Tom und schnippte ein Stückchen Schorf weg. »Aber wir brauchen etwas, womit wir uns ein paar Jahre lang über Wasser halten können und nicht nur ein paar Monate.«
Dieses Gespräch führten sie nicht zum ersten Mal. Doch diesmal unterbrach Benjamin seine Tätigkeit und starrte auf seine teilweise polierten Stiefel. Sie waren alt, mit rissigen Absätzen, die gerichtet werden mussten. Er schaute Ren an. Dann wieder seine Stiefel. Dann durchquerte er auf Strumpfsocken den Raum und verbrachte den Nachmittag damit, gemeinsam mit Tom den Whiskey auszutrinken. Hin und wieder wandte er sich Ren zu, der in der Ecke saß und seinen Blick erwiderte, und mit jedem Mal wurde Benjamins Miene bekümmerter.
Als Ren am nächsten Morgen aufwachte, war Benjamin verschwunden. Er kam erst am Abend zurück, roch nach Tabak und sagte, er habe sich das mit North Umbrage anders überlegt.
Die Männer fingen an, Pläne zu schmieden, und Benjamin ging nicht mehr in die Schenke. Stattdessen brachte er die meiste Zeit damit zu, Zahlen zu addieren und Friedhöfe aufzusuchen und sich Notizen in einem schwarzen Büchlein zu machen, das er stets mit sich herumtrug. Er verschwand oft tagelang aus dem Keller, und fragte man ihn nach seinem Verbleib, antwortete er schlicht: »Ich stelle Nachforschungen an.« Einmal war Ren ihm gefolgt, hatte Straße um Straße überquert, bis hin zum Markplatz, wo er ihn dann in der Kanzlei eines Advokaten verschwinden sah. Als Benjamin wieder herauskam, kaute er an seinen Nägeln herum, und dann blieb er mitten auf dem Gehsteig stehen und lachte laut auf, als hätte ihm jemand gerade etwas Unglaubliches erzählt.
Ren beobachtete ihn jetzt, wie er die Zügel straff hielt und den Karren seitlich an den Spurrillen vorbeilenkte. Sein Blick war nach vorn gerichtet, die Pfeife steckte fest zwischen seinen Lippen, und hinter ihnen schwebten Rauchwölkchen über die Straße.
Bald kamen sie in ein Tal zwischen zwei Hügeln, mit Weiden voller Schafe ringsum. Weiße und braune und schwarzgesichtige Tiere bevölkerten die Landschaft. Der Wagen fuhr an ein paar Farmern vorbei, die ihre Herden im Fluss wuschen, um sie für die Schur vorzubereiten. Die Männer beschrieben ihnen den Weg in die nächste Stadt. Dort stiegen sie in einem Gasthof ab, wo sie ihr letztes Geld für ein Zimmer ausgaben. Die Böden waren staubbedeckt, die Betten voller Tabakflecken und Brandlöcher. Tom setzte sich an den Tisch, und Benjamin packte gemächlich den Koffer aus.
Ren saß still in einer Ecke und las die letzten Seiten seines Buches. Der Hirschtöter lehnte Judith Hutters Heiratsantrag ab. Sie hatte alles versucht, um ihn dazu zu bringen, sie zu lieben, aber es reichte einfach nicht. Ren hatte den Schluss viele Male gelesen und fand ihn immer noch schrecklich. Adlerauge hatte den ganzen Roman hindurch gegen Indianer gekämpft und Unrecht wiedergutgemacht, doch als er Judith ihrem einsamen Schicksal überließ, kam er Ren mit jedem Mal weniger heldenhaft vor.
»Morgen zum Scheren kommen bestimmt viele Leute.« Benjamin klappte den Lederkoffer auf und holte eines der braunen Fläschchen heraus, die mit Doktor Fausts medizinisches Salz für angenehme Träume beschriftet waren.
»Jemand könnte uns erkennen«, meinte Tom.
»Mich erkennen, meinst du.«
»Als würde das eine Rolle spielen.« Tom zog seinen Mantel aus und warf ihn aufs Bett.
»Ich habe eine Idee, wie wir den Jungen einsetzen können.«
»Den solltest du lieber aus dem Spiel lassen.«
»Aber er möchte gern. Nicht wahr, Ren?«
Ren blickte von seinem Buch auf. Er merkte Benjamin an, dass er ganz begierig darauf war, etwas Neues auszuprobieren. Im Lauf des Winters hatte er Ren ausführlich erzählt, was für Gaunereien er begangen hatte: Er hatte sich als Kapitän, als Arzt und als Geistlicher ausgegeben, aus einem Katalog Sachen verkauft, die nie zugestellt wurden, Testamente gefälscht und falsche Urkunden ausgestellt. Alles verlief nach einem ähnlichen Muster: überhöhten Gewinn erzielen, für raschen Besitzwechsel sorgen, und dann so schnell wie möglich fort aus der Stadt. Wenn Benjamin und Tom eine Zeit lang irgendwo bleiben mussten, wandten sie sich den Friedhöfen zu, wo die Opfer umgänglicher waren und sich nicht die Mühe machten, sie zu verfolgen.
Ren klappte sein Buch zu. »Ich möchte es machen.«
Tom schaute besorgt drein. »Ich glaube nicht, dass er bereit dafür ist.«
»Unsinn«, sagte Benjamin.
»Er ist doch noch ein Kind. Er schafft es höchstens, dass sie uns erwischen.«
Benjamin setzte sich auf die Matratze, lehnte sich zurück und zog sich die Decken bis ans Kinn. Er schloss die Augen und stieß einen Schwall Luft aus. »Noch nicht.«
An diesem Nachmittag ging Benjamin los, um etwas zum Abendessen aufzutreiben, und Tom und Ren machten sich daran, die Etiketten Doktor Fausts medizinisches Salz für angenehme Träume durch andere mit der Aufschrift Mutter Jones’ Elixier für unartige Kinder zu ersetzen. Ren weichte die alten Fläschchen ein und kratzte mit einem Messer das Papier ab, während Tom sich mit Federhalter und Tinte an den Tisch setzte und neue Etiketten schrieb; sobald eines fertig war, trank er einen Schluck Whiskey.
Bevor sie Granston verlassen hatten, hatte Tom seinen Bart getrimmt und sich ein neues Hemd gekauft. Jetzt stopfte er eine Serviette in den Kragen, damit es keine Flecken abbekam, und krempelte sorgfältig die Ärmel hoch. Der Lichtschimmer der Kerze flackerte auf seinem Gesicht. Er wirkte ruhig und nahezu nüchtern.
Ren stellte fest, dass Tom bemerkenswert schön schreiben konnte. Die Enden seiner Buchstaben verschlangen sich zu Ornamenten; die Querstriche und Bindestriche verliefen in Wellen von unterschiedlicher Breite. Wenn die Etiketten aufgeklebt waren, sahen sie ziemlich fachmännisch aus. Tom schenkte sich noch ein Glas ein und spreizte seine tintengefleckten Finger.
Ren beugte sich über den Tisch und bewunderte die kunstvolle Schrift. »Warum hast du aufgehört zu unterrichten?«
Tom runzelte die Stirn. Er strich sich mit der Hand übers Gesicht und hinterließ dabei schwarze Tintenstreifen auf seiner Stirn. »Hast du Kameraden?«
»Ich hatte welche«, sagte Ren. »Es waren Zwillinge. Brom und Ichy.«
»Und, fehlen sie dir?«
»Ja«, sagte Ren. Sobald er es aussprach, wusste er, dass es stimmte. Die Zwillinge fehlten ihm in jeder Hinsicht, angefangen damit, dass sie ihn in der Kapelle immer zum Lachen gebracht hatten, bis hin zu ihrer geheimen Zeichensprache beim Abendessen. Sogar das, was ihn sonst furchtbar geärgert hatte, fehlte ihm, etwa dass Brom ihn auch dann noch boxte, wenn er schon aufgegeben hatte, oder dass Ichy sich gern zu etwas bekannte, was er gar nicht getan hatte.
Читать дальше