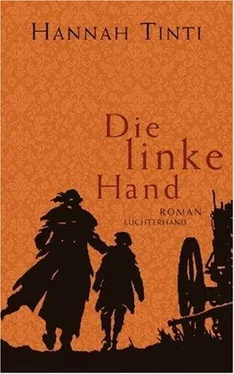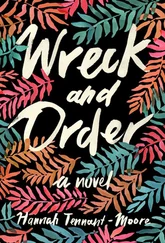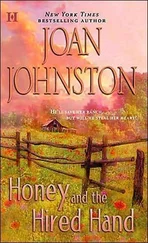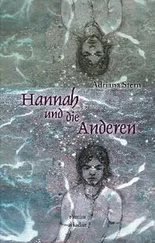»Sieht aus, als hättet ihr die Sachen ausgebuddelt«, sagte Ren.
»Haben wir auch«, sagte Tom. Er begann in seinen Taschen zu wühlen, stellte die Flasche ab, wühlte weiter und zog schließlich ein mehrfach verknotetes Taschentuch hervor. Er schüttelte es, so dass man es klacken hörte, dann warf er es vor Ren auf den Tisch. »Los«, sagte er schließlich. »Mach auf!«
Das Taschentuch war voller Zähne. Ren schüttete sie neben die Halsketten und die Ringe. Es mussten mehrere Dutzend sein, in unterschiedlichen Stadien des Verfalls, einige so groß wie Erbsen, andere voll ausgeformt und fast so groß wie Eicheln, mit spitz zulaufenden, zusammengedrehten Wurzeln. Die Zähne sahen aus wie winzige Porzellanpüppchen ohne Kopf, an denen seitlich noch Reste von rosafarbenem Fleisch hingen, so als hätten sie sich an Menschenfleisch gütlich getan. Blitzschnell zog Ren seine Hand zurück. Allmählich begriff er.
Die Eheringe, die schlaffen Handschuhpaare, die Zähne, die ausgebreitet auf dem Tisch lagen – all das hatten sie den Toten weggenommen. Ren war es, als schwankte der Boden unter ihm, und plötzlich überfiel ihn Angst, als er sich vorstellte, welche Strafe Gott für dieses Vergehen verhängen mochte. Er malte sich aus, wie seine Kumpane in einem Friedhof Gräber öffneten und Sargdeckel wegstemmten; wie ihre Hände die Taschen der Leichen durchwühlten; wie gierig und abscheulich ihre Gesichter dabei aussahen. Und dann gähnte Benjamin. Und Tom kratzte sich den Bart, und sie waren wieder die Alten.
»Es macht zu viel Arbeit, sie rauszuholen«, sagte Benjamin.
»Nicht wenn du bedenkst, für wie viel ich sie verkaufen kann«, sagte Tom. »Ich kenne einen Mann, der behauptet hat, ein gutes vollständiges Gebiss bringt zehn Dollar.« Er zog die Tischschublade auf und kramte darin herum. Schließlich nahm er eine kleine Bürste heraus. »Rutsch rüber«, sagte er zu Ren, setzte sich auf einen Stuhl und goss einen Schuss Whiskey in ein Glas. Er tunkte die Bürste hinein, dann machte er sich an die Arbeit und schrubbte die weichen Reste von den Zähnen.
»Ich habe bei einem Mann Latein gelernt, der überhaupt keine Zähne mehr hatte«, sagte Tom. »Er roch immer nach Lavendelseife. Ein kauziger alter Fuchs war das.«
»Und wie hast du bezahlt?«, fragte Benjamin.
»Meine Mutter hat sein Haus sauber gehalten«, sagte Tom. »Auf diese Weise hat sie meinen Unterricht bezahlt.«
»Zu dumm, dass sie nicht hier ist«, sagte Benjamin.
Tom hörte auf zu bürsten. Sein Mund wurde zu einem Strich. Dann legte er den Zahn weg und griff nach der Flasche.
Benjamin rief Ren zu sich. Er hielt ein Bettelarmband und die Taschenuhr hoch.
»Was, glaubst du, ist mehr wert?«
Die Uhr war aus Gold; in ihr Zifferblatt war ein Baum eingraviert. Das Armband war aus Silber und hatte lauter winzige Musikinstrumente als Anhänger. Ren fingerte an einem klitzekleinen Klavier herum. Er musste an den leblosen Arm denken, den es geschmückt hatte.
»Lass dich nicht ablenken«, sagte Benjamin. Er zog ein Messer aus seinem Stiefel, schob die Klinge in die Rückseite der Uhr und stemmte den Deckel auf. Darunter befanden sich unzählige Rädchen, die alle ineinandergriffen. »Bevor du entscheidest, solltest du dir sämtliche Bestandteile ansehen.« Er passte den Deckel wieder ein und ließ ihn zuschnappen. »Und dann nimmst du immer die Uhr.«
Die Ringe und Halsketten wurden ausgebreitet und begutachtet. Als die Kameen gesäubert waren, erkannte man die fein herausgearbeiteten Bilder – Feengesichter und die Profile wunderschöner junger Frauen. Ein Ohrringpaar funkelte, sobald Benjamin den schmutzigen Belag abrieb, und die Perlen schimmerten im Licht der Laterne wie frisch nachgewachsene Haut.
»Damit kommen wir bis zum Frühjahr über die Runden«, sagte Tom.
Benjamin nickte. Er war mit dem Säubern der Ohrringe fertig und legte sie beiseite. Dann bildete er aus dem restlichen Schmuck Häufchen, schätzte den Wert eines jeden ab und zählte die Beträge mit Hilfe seiner Finger zusammen. Als er ein Paar Handschuhe beiseiteschob, bemerkte er den Hirschtöter, der auf dem Tisch lag.
Tom hörte auf zu bürsten. »Hast du das heute Abend erbeutet?«
Der Indianer auf dem Einband blickte teilnahmslos, während Benjamin das Buch drehte, damit er den Titel auf dem Rücken lesen konnte. Er strich mit dem Finger über die Halskette aus Bärenklauen, dann sah er Ren mit zusammengekniffenen Augen an.
»Ich glaube, das hat ihm Mister Jefferson geborgt.« Benjamin presste die Lippen aufeinander, und Ren spürte, wie ihm flau im Magen wurde. Im Lauf der Jahre hatte er in Saint Anthony eine Menge gestohlen, aber jetzt hatte man ihn zum ersten Mal erwischt.
Toms Blick wanderte zwischen den beiden hin und her, dann wandte er sich grinsend an Ren.
»Wenn ich mir vorstelle, dass ich dich zurückschicken wollte …«
»Nicht zu fassen, dass ich nichts gemerkt habe.« Jetzt lächelte Benjamin. »Zeig mir, wie du es angestellt hast. Nimm etwas anderes.«
Ren ließ einen Moment verstreichen, angespannt und innerlich bereit; dann nahm er die Faust hinter dem Rücken hervor, öffnete sie und zeigte ihnen den Ring, den er zuvor vom Tisch stibitzt hatte. Es war ein goldener Ring mit einem zierlichen Blattmuster. In die Innenseite war ein Datum eingraviert, i83i, dazu die Worte Vergiss mich nicht. Tom und Benjamin beugten sich vor, um besser sehen zu können. Dann lehnten sie sich zurück und brachen in schallendes Gelächter aus.
Benjamin klappte seinen Kragen hoch und fuhrwerkte mit einem Lappen auf dem Buch herum, eine verblüffend präzise Nachahmung von Mr. Jefferson. Dann hetzte er Ren um den Tisch herum und schrie: »Haltet den Dieb!«, während der Junge unter den Stühlen durchkroch und hin und her flitzte, bis Tom sich die Tränen abwischen musste; auch Ren lachte, und es war, als hätte sich eine Spannung im Raum gelöst. Ihre Stimmen schwangen sich bis hinauf in die Ecken, und alle drei schnappten nach Luft.
Benjamin ließ sich auf einen Stuhl plumpsen und streckte beide Beine von sich. Er rieb sich die Nase und richtete seine blauen Augen unverwandt auf Ren, als wäre dieser imstande, die Welt zu erobern.
»Der muss wahrhaftig nichts mehr lernen«, sagte Tom.
»Nein«, sagte Benjamin. »Er ist schon einer von uns.«
In der Werft wurden Schiffe aller Art aus dem Wasser gehoben. Zimmerleute krochen unter den Stützbalken herum; um den Hals trugen sie wollene Schals und an den Händen Handschuhe ohne Finger. Die Männer kratzten die Rückstände von einem halben Jahr des Umherfahrens von den Schiffsrümpfen, entfernten den Muschelbelag und ersetzten das Holz dort, wo es durchgefault war, dichteten die Fugen zwischen den Planken mit Werg und Teer ab. Ren sah ein Schiff im Bau, dessen kahle Rippen, mindestens siebzig Fuß lang, wie Fischgräten in den Himmel stachen. Auf einem Schoner waren die Schiffsbauer gerade dabei, den Mast zu setzen, einen gewaltigen, von seinen Ästen befreiten und glatt gehobelten Baumstamm, der langsam mit Seilen an Ort und Stelle gehievt und dann, gut geschmiert, in den Bauch des Schiffes hinabgelassen wurde.
Neben der Werft gab es eine Ladenzeile, wo Flaschenzüge und Netze und Tauwerk verkauft wurden, Messingbeschläge und Segel und Anker; Salz und Eis und Ruder und Ölzeug und Eimer und Harpunen. Es roch nach Handel, nach Holzspänen und Politur. Tom führte sie um die Ecke zu einem wackeligen Treppenaufgang. Seitlich am Gebäude war ein verblasstes Schild angenagelt, auf dem in roter Schrift mister bowers, zahnheilkunde und zahnersatzstand. Die darunter ins Holz eingebrannte Hand zeigte die steile Wendeltreppe hinauf.
Tom und Benjamin sahen einander an, dann gaben sie Ren einen leichten Schubs, und der Junge stieg langsam die Treppe hinauf, gefolgt von den beiden Männern. Das Geländer wackelte, und die Stufen drohten unter ihren Füßen durchzubrechen. Noch ehe Ren oben angelangt war, schob sich ein Männerkopf über den Rand des Geländers und schaute zu ihnen herunter.
Читать дальше