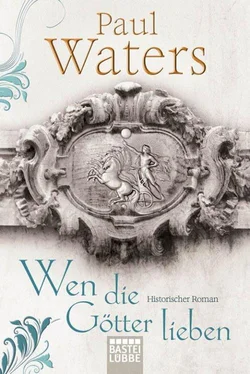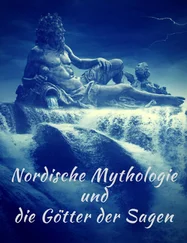Dem Kutter, der uns von Gallien hergebracht hatte, hatte ich befohlen, die Themse hinauf nach London zu segeln. Er lag wartend am Kai. Lupicinus hatten wir gesagt, dass wir in Britannien zu bleiben gedachten, um private Geschäfte zu erledigen. So standen wir schließlich am Ufer, um Lupicinus zu verabschieden. Als das schnittige schwarze Schiff bei ablaufendem Wasser ablegte – Lupicinus stand in erhabener Pose am Bug –, wagte ich kaum, Marcellus anzusehen, aus Furcht, die Erleichterung könnte sich auf meinem Gesicht abmalen.
Erst nachdem der Kapitän den Ruderern seine Befehle zurief und der Kutter sich der Brücke näherte, stieß ich einen tiefen Seufzer aus und wandte mich Marcellus zu.
»Ich frage mich, ob er tatsächlich gegen Julian ins Feld gezogen wäre.«
Marcellus blickte dem Schiff hinterher. Die Riemen, die weiß und rot gegen den schwarzen Rumpf abstachen, hoben und senkten sich in präzisem Takt. Die Passanten auf der Brücke blieben am Geländer stehen und gafften.
»Vermutlich«, meinte er stirnrunzelnd. »Er bringt dem Westen keine Loyalität entgegen. Er ist durch und durch Constantius’ Geschöpf. Ich glaube aber nicht, dass die Männer ihm gefolgt wären.«
Draußen auf dem Fluss hisste der Kutter die Segel; das große rote blähte sich im Wind. Lupicinus stand in der strammen soldatischen Haltung, die er gern zur Schau trug, an der Reling, den Blick nach vorn gerichtet, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ich war froh, dass er uns nicht gewinkt oder ein Lebewohl zugerufen hatte. Es war zu viel Täuschung im Spiel gewesen, und in Boulogne erwartete ihn die Verhaftung, wie ich wusste.
An jenem Abend speisten wir mit Alypius in seiner Residenz, unsere erste reichhaltige Mahlzeit seit vielen Tagen. Dabei tranken wir guten Wein aus Bordeaux und erzählten ihm, dass wir zu Marcellus’ Gut hinausreiten wollten.
Nachdem die Tische abgeräumt und die Diener hinausgeschickt worden waren, beugte Alypius sich auf seiner Liege vor und sagte: »Da wir nun allein sind, erzählt mir doch, wie Julian seine Akklamation zustande gebracht hat.«
»Er hat es gar nicht gern getan«, stellte ich richtig. »Er war genauso überrascht wie wir.« Marcellus und ich berichteten von den Vorfällen, die zu jener Nacht in Paris geführt hatten, als die Soldaten den Palast stürmten.
Am Ende sagte Alypius: »Dann ist Julian noch so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich dachte schon, die Zeit hätte ihn verändert. Er war nie an Macht interessiert, müsst ihr wissen. Er wollte immer nur in Athen bei seinen Philosophenfreunden bleiben.«
»Mir scheint, er sehnt sich noch immer nach Athen zurück. Er würde sogar dafür kämpfen. Doch er hat sich anders entschieden.« Ich erzählte ihm von Eutherius’ diplomatischer Mission bei Constantius und wie sehr Julian auf eine Beilegung des Konflikts hoffte.
Alypius schüttelte den Kopf. »Ich bezweifle, dass er zuhört.«
»Vielleicht nicht«, pflichtete ich ihm bei und dachte an Eutherius’ Bemerkung gegenüber Julian, »es sei denn, er ist dazu gezwungen. Es heißt, dass er niemandem traut.«
»So ist es. Das ist wohl der Nachteil, wenn man höchste Macht ausübt, einen mittelmäßigen Verstand hat und zu lange von zu vielen Schmeichlern und Betrügern umgeben war.«
Marcellus fragte ihn, ob er glaube, dass es zum Krieg kommen werde.
Alypius überlegte ein paar Augenblicke, den Weinpokal in der Hand.
»Ich werde euch sagen, was ich glaube«, entgegnete er schließlich und stellte den Pokal neben sich auf das dreibeinige Tischchen. »Constantius wird Julian zermalmen, wenn er es für möglich hält, und seine Ratgeber werden ihn dazu ermutigen, besonders dieser unausstehliche Oberkämmerer. Doch wenn Julian sich in eine stärkere Position bringen kann, könnte das Glück sich zu seinen Gunsten neigen.«
Später beim Nachtisch, einem Früchtekuchen, der mit mauretanischen Feigen in süßem Wein serviert wurde, erzählte Alypius, wie er Julian zum ersten Mal begegnet war, in einem Sommer in Nikomedia, wo er seine Philosophenfreunde besuchte. Alypius saß damals unter den ausladenden Zweigen einer Platane vor dem Tempel der Demeter und plauderte mit seinen Freunden, als ihm ein stiller, gleichmütig wirkender Knabe auffiel, der in der Kolonnade stand. Er hätte keinen weiteren Gedanken an ihn verschwendet, hätte der Knabe sich nicht kurz darauf genähert und sich auf eine Stufe gesetzt, wo er das Gespräch verfolgen konnte.
»Als ich ihn dort sah, forderte ich ihn auf, zu uns zu kommen und zuzuhören; wir hätten nichts zu verheimlichen. Und das tat er dann auch, bis sein Erzieher, ein Christenpriester, aufgeregt herbeigelaufen kam und ihn scheltend wegführte.«
Er dachte lächelnd daran zurück und fuhr fort: »Jahre später trafen wir uns wieder, und ich rief ihm unsere erste Begegnung ins Gedächtnis. Darüber wurden wir Freunde. Damals war er wie ein Hungerleider, der durch glückliche Umstände an den Tisch eines Reichen geraten ist, so groß war sein Appetit auf Wissen … So vieles hatten sie ihm vorenthalten«, fügte er kopfschüttelnd hinzu.
Ich stellte fest, dass ich Alypius mochte. Nach seiner Heimatstadt Antiochia gefragt, beschrieb er mit Wehmut in den Augen die schattigen Lorbeeralleen, die Weinterrassen an den Berghängen, die Bibliotheken und Badehäuser und das ständige Vergnügen gebildeter Gesellschaft.
»Wie gern würde ich die Stadt eines Tages wiedersehen«, sagte er.
»Dann solltest du dich beeilen, denn die Christen werden bald alle Freuden beseitigen, die Antiochia zu bieten hat: die Universität, die Bibliotheken, das Theater. Das alles verabscheuen sie. Und jedes Jahr werden sie mehr und die guten Männer weniger. Sie werden erst zufrieden sein, wenn Antiochia so trostlos ist wie eine Maultierstation in der Wüste.«
So wandte sich unser Gespräch den Christen zu. Marcellus erzählte, wir hätten die neue Kathedrale des Bischofs gesehen, oben auf dem Hügel des alten Tempels der Diana, den er hatte abreißen lassen. »Lauter nackte Ziegel und Baugerüste. Ich hatte erwartet, dass sie inzwischen fertig ist; er baut lange genug daran.«
»Ach, der Bischof«, sagte Alypius mit einer müden Geste. »Er hat Glück, dass sein hässlicher Bau überhaupt steht. Hätte ich meine Garde nicht eingreifen lassen, der Pöbel hätte ihn geschleift.«
»Dabei hat er immer behauptet, die gemeinen Leute seien seine größten Freunde«, bemerkte ich trocken.
»Das behaupten solche Männer immer. Doch die Unterstützung des Pöbels ist so unberechenbar wie die Liebe einer Kurtisane – und genauso käuflich. Das hat er selbst feststellen müssen, nachdem ihm die Mittel ausgegangen sind. Nun geben sie ihm die Schuld an ihrem Elend. Er hat seiner Sache sehr geschadet.«
»Der Pöbel sollte sich selbst die Schuld geben«, sagte Marcellus bitter.
»Ganz recht. Doch ist es nicht die Art der gemeinen Leute, die eigene Torheit einzugestehen. Stattdessen behaupten sie, der Bischof habe sie übers Ohr gehauen. Als er sie nicht mehr beköstigen konnte, gingen sie zu den Ratsherren, die sie einst aus der Stadt vertrieben hatten, und baten um ihre Rückkehr. Nun schmollt der Bischof in seinem unvollendeten Palast und wartet auf das Ende der Welt. In der Zwischenzeit beten die Leute still die alten Götter an, und die Provinz blüht auf.«
Er aß die letzte Feige aus dem Schälchen, stellte es ab und klingelte nach dem Diener. »So sind nun mal die Dummen; sie ändern sich nicht. Marcellus, dein Becher ist leer.«
Am nächsten Morgen, es war ein klarer, heller Frühlingstag, ritten wir zu Marcellus’ Villa auf dem Land westlich von London und freuten uns, nach so widerwärtiger Arbeit wieder allein zu sein. Ringsumher blühten die Wiesen; ein frischer, sauberer Wind wehte uns ins Gesicht.
Bis wir die alte Umfassungsmauer erreichten, versank die Sonne in einer leuchtend roten Wolkenbank. Marcellus war schon vor einer Weile still geworden, und ich wusste, dass er Vermutungen anstellte, was er wohl vorfinden würde.
Читать дальше