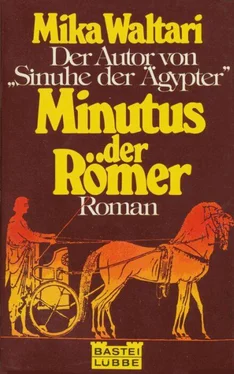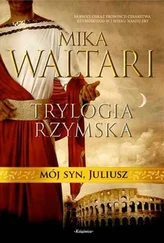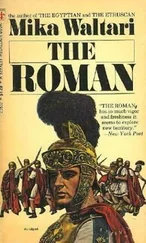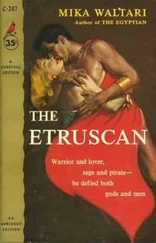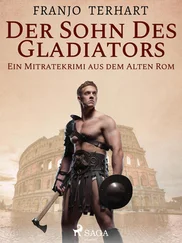Claudia, die in diesen Tagen wie alle Schwangeren empfindlich war, begann zu weinen und rief: »Ich glaube nicht einmal, daß mein armer Vater mich wirklich haßte. Er ist nur so beeinflußt worden, zuerst von der unglückseligen Messalina und dann von der niederträchtigen Agrippina, daß er es nicht wagte, mich als seine Tochter anzuerkennen, selbst wenn er es gewollt hätte. In meinem Herzen habe ich ihm bereits verziehen.«
Als ich über die juristische Seite der Sache nachdachte, fiel mir ein, wie rasch ich Jucundus zum römischen Bürger gemacht hatte. »Claudia war gezwungen, sich jahrelang in einer Landstadt versteckt zu halten«, sagte ich vorsichtig. »Es ließe sich vielleicht so einrichten, daß sie in die Bürgerrolle irgendeines abgelegenen Ortes eingeschrieben wird, und zwar als Tochter eines bereits verstorbenen Vaters A und einer ebenfalls dahingeschiedenen Mutter B. Man brauchte nur eine kleine Stadt zu wählen, in der etwa ein Brand das Archiv zerstört hat. Es gibt ja Millionen römischer Bürger in den verschiedensten Ländern, und wir wissen, daß so mancher Zugewanderte behauptet, römischer Bürger zu sein, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, weil es zur Zeit nicht möglich ist, ihm das Gegenteil zu beweisen. Auf diese Weise könnte ich Claudia heiraten.«
Claudia fuhr mich zornig an: »Laß mich mit deinem Alphabet in Frieden. Ich will weder A zum Vater noch B zur Mutter. Mein Vater war Tiberius Claudius Drusus, und meine Mutter war Plautia Urgulanilla. Immerhin danke ich dir dafür, daß du die Möglichkeit zu erwägen geruhst, mich zu heiraten. Ich fasse deine Worte als eine Werbung auf, und ich habe hier zwei achtbare Zeugen.«
Paulina und Antonia beeilten sich, mich lächelnd zu beglückwünschen. Ich war in eine Falle gegangen und hatte mich doch eigentlich nur rein theoretisch zu einem juristischen Problem geäußert. Nach einigem Hin und Her kamen wir überein, eine Urkunde über Claudias Herkunft aufzusetzen, die Antonia und Paulina als Geheimdokument im Archiv der Vestalinnen hinterlegen sollten.
Die Hochzeit sollte in aller Stille stattfinden, ohne Opfer und Festlichkeiten, und in die Bürgerrolle sollte Claudia unter dem Namen Plautia Claudia Urgulanilla eingetragen werden. Daß die Behörden keine überflüssigen Fragen stellten, dafür hatte ich zu sorgen. Claudias Stellung brauchte keine Veränderung zu erfahren, denn sie stand längst mit allen Vollmachten meinem Hause vor.
Ich ging schweren Herzens auf alles ein, da mir keine andere Wahl blieb, und fürchtete, auf die übelste Art und Weise in eine politische Verschwörung gegen Nero verwickelt worden zu sein. Tante Paulina dachte gewiß an nichts dergleichen, aber Antonia sagte zuletzt ganz offen: »Ich bin einige Jahre jünger als Claudia, aber Nero erlaubt mir nicht, noch einmal zu heiraten. Und kein vornehmer Mann würde es wagen, sich mit mir zu vermählen, denn jeder weiß, wie es Faustus Sulla erging. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Sulla nicht so täppisch gewesen wäre. Er verstand es nicht, Fortuna beim Schopf zu fassen. Deshalb freute ich mich nun, daß Claudia als Tochter des Kaisers heiraten kann, wenn auch nur heimlich. Deine Durchtriebenheit, lieber Minutus, deine Rücksichtslosigkeit und dein Reichtum ersetzen vielleicht die anderen Eigenschaften, die ich mir von Claudias Gatten gewünscht hätte. Denke immer daran, daß du dich durch diese Heirat sowohl mit den Claudiern als auch mit den Plautiern verbindest.«
Paulina und Claudia baten uns, mit ihnen zusammen zu beten, daß unser Bund im Namen Christi gesegnet werde. Antonia lächelte verächtlich, sagte jedoch: »Mir ist ein Name so recht wie der andere, wenn ihr an seine Macht glaubt. Ich unterstütze seine Partei, weil ich weiß, wie sehr die Juden ihn hassen, deren Einfluß unerträglich wird. Poppaea verhilft ihnen zu Ämtern, und Nero überschüttet einen jüdischen Pantomimiker mit den kostbarsten Geschenken, obwohl der Kerl sich frech weigert, am jüdischen Sabbat aufzutreten.«
Die stolze Antonia dachte in ihrer Verbitterung offenbar an nichts anderes, als wie sie Nero und Poppaea mit allen Mitteln schaden könnte. Sie konnte gefährlich sein, obgleich sie keinen Einfluß mehr besaß, und ich war froh, daß sie so viel Verstand bewiesen hatte, erst nach Einbruch der Dunkelheit und in einer Sänfte mit geschlossenen Vorhängen in mein Haus zu kommen.
Ich war so niedergeschlagen, daß ich den letzten Rest von Stolz ablegte und mich an dem christlichen Gebet beteiligte und um Vergebung meiner Sünden bat. Ich brauchte Hilfe, einerlei woher sie kam. Kephas und Paulus und mehrere andere heilige Christen hatten immerhin in Christi Namen Wunder gewirkt. Als die Gäste gegangen waren, trank ich sogar mit Claudia aus dem Zauberbecher meiner Mutter, und dann legten wir uns, nach langem wieder miteinander ausgesöhnt, schlafen.
Wir schliefen nach diesem Tage zusammen, als wären wir schon Ehegatten, und niemand im Haus machte ein Aufhebens davon. Ich will auch nicht leugnen, daß es mir schmeichelte, das Bett mit einer Kaisertochter zu teilen. Dafür ging ich auf Claudias Wünsche ein und unterwarf mich während der Zeit der Schwangerschaft allen ihren Launen. Die Folge davon war, daß die Christen mein Haus endgültig zu ihrer Heimstatt machten. Ihre Lobpreisungen hallten von morgens bis abends so laut durch die Gegend, daß sogar die Nachbarn gestört wurden.
Es hatte, von einigen Gewittern abgesehen, lange nicht geregnet. Ganz Rom litt unter Hitze, Schmutz, üblen Gerüchen und Staub. In meinem Garten auf dem Aventin war das Laub der Bäume mit einer dicken Staubschicht bedeckt, und das Gras raschelte vor Dürre. Allein Tante Laelia genoß die Hitze. Sie, die vor Alter ständig fror, ließ sich aus den kühlen inneren Räumen in den Garten hinaustragen, sog schnuppernd die Luft ein und sagte: »Ein richtiges Brandwetter ist das.«
Sie schien für Augenblicke wieder klar im Kopf zu sein und berichtete zum hundertsten Male lebhaft von der Feuersbrunst, die vor vielen Jahren den ganzen Aventin verheert hatte. Der Bankier meines Vaters hatte damals die verwüsteten Grundstücke billig aufgekauft und Mietshäuser darauf errichten lassen, aus denen ich meine Einkünfte bezogen hatte, bis ich sie im vergangenen Winter vorteilhaft verkaufte.
Als ich eines Tages wieder in meinem Garten war, glaubte ich einen Rauchgeruch wahrzunehmen. Ich achtete jedoch weiter nicht darauf und redete mir sogar ein, ich müsse mich getäuscht haben, da ich wußte, daß in dieser Sommerhitze die Brandwachen in allen Stadtbezirken wachsam Ausschau hielten und daß es verboten war, ohne besondere Notwendigkeit Feuer anzuzünden. Es wehte auch kein Wind. Die Luft war vom frühen Morgen an sengend heiß und stickig gewesen.
Irgendwo in der Ferne hörte ich Hornsignale und ein seltsames Brausen, aber erst als ich mich in die Stadt begab, stellte ich erschrocken fest, daß die ganze dem Palatin zugekehrte Längsseite der großen Rennbahn in hellen Flammen stand. Ungeheure Rauchwolken stiegen von den Wachs-, Weihrauch- und Tuchläden auf. Diese leicht entzündlichen kleinen Buden hatten keinerlei Brandmauern, weshalb das Feuer mit Blitzesschnelle um sich griff.
Um die große Brandstätte herum wimmelten die Menschen durcheinander wie Ameisen, und ich glaubte die Löschmannschaften von mindestens drei Stadtbezirken zu erkennen, die breite Brandgassen schlugen, um das rasende Flammenmeer einzudämmen. Eine solche Feuersbrunst hatte ich nie zuvor gesehen. Es war ein beklemmender Anblick, aber noch machte ich mir keine allzu großen Sorgen. Im Gegenteil, ich fand, die Löschmannschaft unseres eigenen Stadtteils hätte sich nicht den anderen anschließen sollen, sondern bleiben, wo sie war, und den Hang des Aventins bewachen.
Ich schickte einen meiner Begleiter zurück, um Claudia und die Hausgenossen zu warnen. Auf dem Weg zum Tiergarten ging ich kurz bei der Präfektur vorbei, um mich zu erkundigen, wie der Brand entstanden war. Man hatte einen reitenden Eilboten ausgeschickt, der meinen ehemaligen Schwiegervater von seinem Landgut holen sollte, aber der Stellvertreter des Präfekten fühlte sich seiner Aufgabe durchaus gewachsen.
Читать дальше