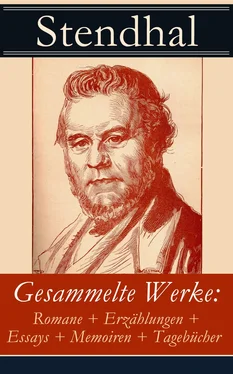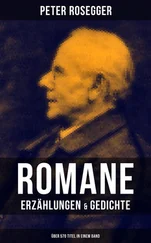Die Freude der Liebenden war grenzenlos. Um den Sieg auszunutzen, antwortete sie auf der Stelle:
»Herr von La Vernaye würde Dir vor Dankbarkeit zu Füßen fallen, wenn er alles das wüßte, was Du gnädigst für ihn getan hast. Aber bei aller Großmut hat mein Vater mich vergessen. Die Ehre seiner Tochter steht auf dem Spiel. Kompromittiert, verfalle ich ewiger Schande, die keine noch so hohe Jahresrente wieder gutmachen kann. Ich werde das Patent nur an Herrn von La Vernaye weiterschicken, wenn Du mir Dein Wort gibst, daß meine Hochzeit im Laufe der nächsten vier Wochen öffentlich in Villequier gefeiert wird. Es ist die höchste Zeit. Bald wird Deine Tochter nur noch als Frau von La Vernaye öffentlich erscheinen dürfen.
Herzlichst danke ich Dir, daß Du mich vor dem Namen Sorel gerettet hast…!«
Es kam die unerwartete Antwort:
»Gehorche, oder ich mache alles rückgängig! Büße nur Deine Torheit in Hangen und Bangen! Noch kenne ich Deinen Julian nicht und Du erst recht nicht. Er soll nach Straßburg gehen und sich dort gut führen. In vierzehn Tagen erfährst Du meine weiteren Absichten.«
Dieser energische Brief setzte Mathilde in Erstaunen.
»Noch kenne ich Julian nicht!« Dieser Satz machte sie nachdenklich. Schließlich aber verlor sie sich in den holdesten Träumereien, die sie mit der Wirklichkeit verwechselte. »Mein genialer Julian paßt nicht in die armselige Uniform der guten Gesellschaft. Mein Vater glaubt an seine Überlegenheit nicht, und zwar gerade in Hinsicht auf Dinge, die sie beweisen…
Allerdings: füge ich mich dieser Anwandlung von Energie nicht, so kann es zu einem öffentlichen Skandal kommen. Ein Bruch mit meinem Vater verringert mein gesellschaftliches Ansehen und macht mich am Ende auch Julian weniger begehrenswert. Dazu die Armut! Nein, die Torheit, einen Mann seiner Persönlichkeit wegen zu wählen, ist nur im Reichtum nicht lächerlich. Sobald ich fern von meinem Vater lebe, vergißt er mich wahrscheinlich. Er ist betagt. Norbert wird eine liebenswürdige und gewandte Frau heiraten. Wurde Ludwig XIV. in seinem Alter nicht von der Herzogin von Burgund berückt?«
Sie entschloß sich zum Gehorsam, jedoch hütete sie sich, den väterlichen Brief Julian mitzuteilen. Bei seiner heftigen Natur konnte er leicht etwas Unbedachtes begehen.
Als sie ihm am Abend die Nachricht überbrachte, er sei Husaren-Oberleutnant, kannte seine Freude keine Grenzen. Sein Ehrgeiz; frohlockte. Die Namensänderung kam ihm ganz unerwartet.
»Alles in allem«, sagte er sich, »ist mein Roman nun zu Ende. Ich habe meine Sache vorzüglich gemacht. Ich habe es fertiggebracht, vom hochmütigsten aller Wesen geliebt zu werden. Der Marquis kann ohne sie nicht leben, und Mathilde nicht ohne mich.«
Seine Seele flog in die Weite. Kaum erwiderte er Mathildens Liebkosungen. Still und versonnen saß er da. Niemals aber war er ihr so anbetungswürdig, so groß und genial erschienen. Nur bangte ihr, sein Stolz könne durch irgendwelchen Mißklang verletzt werden. Sie hatte Angst vor einem Zwischenfall, der mit einem Schlage alles wieder veränderte.
Fast alle Vormittage sah sie den Pfarrer Pirard ins Haus kommen. Sollte Julian durch ihn nicht über die Absichten ihres Vaters einigermaßen unterrichtet sein? Konnte ihm der Marquis schließlich nicht selber geschrieben haben? Wie sollte sich Mathilde Julians ernste Miene nach einem so großen Glücke sonst erklären? Sie wagte nicht zu fragen.
Sie wagte es nicht! Sie, Mathilde von La Mole!
Von Stund an war ihre Liebe zu Julian, ihr ganzes Gefühlsleben durchzittert von etwas Vagem, Bangem, Grauenhaftem. Die Leidenschaft, deren eine inmitten der Überkultur einer Weltstadt groß gewordene kühle Seele überhaupt fähig ist, hatte ihren Höhepunkt erreicht.
Am andern Morgen in der Frühe fand sich Julian im Pirardschen Pfarrhause ein. Alsbald fuhr eine in der nächsten Posthalterei gemietete alte wackelige Postkutsche in den Hof ein.
»Es ist zum letzten Male, daß Sie in solch einem Wagen fahren. Das schickt sich nicht mehr für Sie«, bemerkte der Abbé mürrisch. »Hier sind zwanzigtausend Franken, die Ihnen Herr von La Mole zur Verfügung stellt, unter der Bedingung, daß Sie diese Summe im Laufe eines Jahres ausgeben, ohne sich dabei allzu lächerlich zu machen…«
Eine so hohe Summe in der Hand eines jungen Mannes dünkte den Pfarrer eine ungeheuerliche Verführung zur Sünde.
»Ich habe den Marquis endlich dazu gebracht«, fuhr Pirard fort, »sich mit dem Abbé von Frilair, dem Erzjesuiten, zu versöhnen. Er ist uns zu mächtig. Eine stillschweigende Bedingung dieses Vergleichs wird die Anerkennung Ihrer adligen Herkunft durch diesen Mann sein, der in Besançon regiert.«
Julian konnte seine innige Freude nicht verbergen. Jetzt war er anerkannt! Er fiel dem Pfarrer um den Hals.
»Pfui!« rief Pirard und stieß ihn von sich. »Was soll diese weltliche Eitelkeit?« Geschäftlichen Tones fuhr er fort: »Es ist der Wunsch des Herrn Marquis, daß Herr von La Vernaye es für angebracht erachtet, seinem Pflegevater, dem Herrn Sägemüller Sorel zu Verrières, ein Geschenk zu machen. Besser aber werde ich dies statt Ihrer tun. Ich werde Herrn Sorel und seinen beiden Söhnen jedem ein Jahresgeld von fünfhundert Franken aussetzen, das gezahlt werden soll, solange ich mit ihnen zufrieden bin.«
Julian hatte seinen kühlen Hochmut wiedergewonnen. Er sprach seinen Dank aus, aber in allgemein gehaltenen Worten, die zu nichts verpflichteten. Bei sich dachte er: »Ob ich nicht doch der natürliche Sohn eines der großen Herren bin, die der schreckliche Napoleon in unsre Berge verbannt hat?« Allmählich kam ihm diese Vermutung immer weniger unmöglich vor. »Ein Beweis dafür wäre schließlich auch mein Haß gegen meinen Vater. Dann wäre ich kein Ungeheuer mehr!«
Einige Tage nach diesem Selbstgespräch exerzierte das 15. Husarenregiment, eines der glänzendsten der französischen Armee, auf dem Exerzierplatz von Straßburg. Der Chevalier von La Vernaye ritt das schönste Pferd im ganzen Elsaß. Es hatte ihn sechstausend Franken gekostet. Er war als Oberleutnant eingestellt, ohne je mehr als auf dem Papier Leutnant in einem andern Regiment gewesen zu sein, von dem er keine Ahnung hatte.
Sein blasiertes Aussehen, seine ernsten, fast bösen Augen und seine unwandelbare Kaltblütigkeit sicherten ihm vom ersten Tage an Respekt und Ansehen. Dazu kamen seine vollendete gemessene Höflichkeit und seine ohne Prahlerei zutage tretende Fertigkeit im Schießen und Fechten. Von vornherein verstummte jede Widerrede. Nach ein paar Tagen hatte er die öffentliche Meinung des Regiments auf seiner Seite. Ein Witzbold unter den älteren Offizieren bemerkte: »Dem jungen Manne fehlt nichts, nur die Jugend!«
Von Straßburg aus schrieb Julian an Chélan, den hochbetagten Pfarrer von Verrières, unter anderm:
»Gewiß haben Sie zu Ihrer Freude vernommen, daß sich meine Familie veranlaßt gesehen hat, mich wohlhabend zu machen. Anbei sind fünfhundert Franken, die ich Sie bitte, unauffällig und ohne Nennung meines Namens unter die Armen zu verteilen, zu denen ich ehedem selber gehörte. Gewiß helfen Sie andern noch immer so gern wie einst mir.«
Julian war trunken vor Ehrgeiz, nicht vor Eitelkeit. Allerdings verwendete er auf sein Äußeres große Sorgfalt. Seine Pferde, seine Uniformen, die Livree seiner Diener, alles das war derart tadellos, daß sich damit kein englischer Lord hätte zu schämen brauchen.
Kaum war er Offizier – freilich nur durch Protektion –, als er sich bereits ausrechnete, daß er mit seinen dreiundzwanzig Jahren eigentlich mehr sein müßte als bloß Oberleutnant, wenn er wie alle großen Heerführer mit dreißig Jahren General sein wollte. Er dachte an nichts andres als an eine glänzende Karriere und an seinen Sohn.
Читать дальше