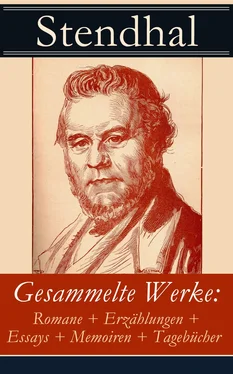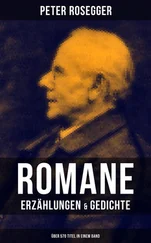Zürne ihm nicht lange! Was hätte es für Sinn? Mein Fehltritt ist nicht wieder gutzumachen. Wenn Du es forderst, so will ich es übernehmen, Dir die Versicherung seiner tiefsten Ehrfurcht zu übermitteln, zugleich mit der Beteuerung, daß es ihm unsagbar schmerzlich ist, Dir Kummer zu bereiten. Du wirst ihn nicht wiedersehen wollen. Aber seine Wege werden immerdar meine Wege sein. Das zu verlangen ist sein Recht und dies zu tun meine Pflicht, denn er ist der Vater meines Kindes.
Wenn Du die Güte hast, uns jährlich sechstausend Franken zum Lebensunterhalt auszusetzen, so werde ich dies dankbar annehmen. Andernfalls will sich Julian als Lehrer für Latein und Literatur in Besançon niederlassen. Wie tief unten er auch anfangen mag, so bin ich doch sicher, daß er sich emporarbeitet. Mit ihm fürchte ich mich nicht vor der Niedrigkeit. Sollte es eine Revolution geben, so wird er sicher eine der ersten Rollen spielen. Könntest Du ein Gleiches von irgendeinem der andern sagen, die sich um meine Hand beworben haben? Julian würde selbst unter der gegenwärtigen Regierung eine hohe Stellung erreichen, wenn er eine Million und die Fürsprache meines Vaters besäße.
Der Brief war absichtlich acht Seiten lang. Mathilde wußte genau, daß ihr Vater unter dem ersten Eindrucke ihres Briefes handelte.
Um die Zeit, da der Marquis den Brief lesen mußte, fragte sich Julian: »Was wird nun? Worin besteht: erstens meine Pflicht, zweitens mein Vorteil? Was ich dem Marquis verdanke, ist unberechenbar. Ohne ihn wäre ich immer noch ein subalterner Schelm, und doch nicht Schelm genug, um mich vor dem Hasse und der Verfolgung der andern zu bewahren. Durch den Marquis bin ich ein Mann der Welt geworden. Wenn ich fernerhin Schelmereien begehen muß, so geschieht dies nur hin und wieder und nicht in plumper Art. Das ist mehr wert, als wenn er mir eine Million geschenkt hätte. Ich verdanke ihm meinen Orden und die Manieren eines Diplomaten. Das wird mich mancher Verlegenheit entheben…«
Plötzlich wurde er von dem alten Kammerdiener des Marquis unterbrochen: »Der Herr Marquis wünscht Sie sofort zu sprechen, gleichgültig in welchem Anzuge.« Flüsternd setzte er hinzu: »Exzellenz ist maßlos in Wut. Nehmen Sie sich in acht!«
Es war in der Tat so. Vielleicht zum ersten Male in seinem ganzen Leben war dieser Grandseigneur gemein. Er überhäufte Julian mit allen möglichen Schimpfworten, die ihm gerade in den Sinn kamen.
Julian war erstaunt und beunruhigt, aber seine Dankbarkeit wankte nicht. Er mußte sich sagen: »Diesem armen Manne brechen mit einem Male hohe langgehegte Pläne zusammen. Ich schulde ihm Rede und Antwort. Wenn ich stumm bleibe, steigert sich nur sein Zorn.«
Ein klassisches Zitat fiel ihm ein.
Und so sagte er:
» Ich bin ein Mensch. Ich habe Euer Exzellenz untertänigst gedient. Ich bin generös bezahlt worden. Ich bin voll aufrichtiger Dankbarkeit. Aber ich bin zweiundzwanzig Jahre alt. Hier im Hause hat mich niemand verstanden, nur Euer Exzellenz und dieses holdselige Wesen…«
»Bestie!« brüllte der Marquis. »Holdselig, holdselig! An dem Tage, da Ihnen meine Tochter holdselig erschien, hatten Sie sich zum Teufel zu scheren!«
»Ich habe den Versuch gemacht. Es war damals, als ich bat, nach dem Languedoc gehen zu dürfen.«
Müde des Hin-und Herrasens und überwältigt von seinem Schmerze, sank der Marquis in einen Lehnstuhl. Julian hörte, wie er halblaut vor sich hinsagte: »Ein böser Mensch ist er nicht!«
»Nein! Gegen Eure Exzellenz bin ich es nicht!« rief Julian, indem er vor dem Marquis in die Knie sank. Aber alsbald schämte er sich seiner Rührung und sprang schnell wieder auf.
Der Marquis hatte sich in vage Gedanken verloren. Julians Kniefall brachte ihn wieder zu sich. Von neuem überschüttete er ihn mit den ärgsten Schmähungen, im Tone eines Droschkenkutschers. Gegen seine sonstige Art so zu schimpfen war ihm offenbar eine Erleichterung.
»So! Meine Tochter soll eine simple Frau Sorel werden und keine Herzogin?« Dieser Zwilligsgedanke, der ihm immer wieder klar zum Bewußtsein kam, verursachte immer neue Wutanfälle, die ihn jedweder Selbstbeherrschung beraubten. Julian fürchtete mißhandelt zu werden.
In den lichten Zwischenzuständen, in denen der Marquis anfing, sich in sein Unglück zu schicken, klangen seine Vorwürfe bereits ziemlich vernünftig.
»Sie hätten fliehen müssen, Herr Sorel!« sagte er. »Es war Ihre Pflicht, mein Haus zu verlassen… Sie sind der verworfenste Mensch…
Julian trat an den Schreibtisch und kritzelte auf eine Karte:
»Seit langem des Daseins überdrüssig, mache ich ihm ein Ende. Eure Exzellenz bitte ich ganz gehorsamst unter der Versicherung meiner unbegrenzbaren Dankbarkeit um gütige Nachsicht, wenn mein Tod einige Unannehmlichkeiten im Hause verursachen sollte.«
Dem Marquis das Geschriebene reichend, erklärte er:
»Wollen Eure Exzellenz die Güte haben, diese Karte zu lesen. Schießen Sie mich nieder oder lassen Sie dies durch Ihren Kammerdiener tun! Es ist ein Uhr nachts. Ich werde im Park an der Hintermauer auf und ab gehen…«
Damit schritt er nach der Tür.
»Scheren Sie sich zum Teufel!« rief ihm der Marquis nach.
»Ich verstehe«, dachte Julian bei sich. »Es würde ihm nicht unangenehm sein, wenn ich mir selber eine Kugel vor den Kopf schösse … Nein! Er soll es tun! Ich biete ihm diese Genugtuung… Aber, Gott verdamm’ mich, ich liebe das Leben! Ich bin es meinem Sohne schuldig!«
Jetzt erst trat ihm der Gedanke daran klar vor die Seele. Er dachte an nichts andres mehr, nachdem er in den ersten Augenblicken dem Gefühle der Gefahr Raum gegeben hatte. Dieses völlig neue Ziel stimmte ihn besonnen. »Ich bedarf eines guten Ratgebers, wenn ich mit diesem jähzornigen Manne fertig werden will. Er hat den Kopf verloren und ist zu allem fähig. Fouqué ist zu weit fort. Abgesehen davon ist es ihm unmöglich, ein Herz wie das des Marquis zu verstehen … Graf Altamira? Bin ich aber seiner ewigen Verschwiegenheit sicher? Ich darf mich nicht noch tiefer ins Unglück reiten … Ach, es bleibt mir niemand übrig als der trübselige Pfarrer Pirard … Der Jansenismus hat seinen Gesichtskreis verengt … Ein verschlagener Jesuit, der die Welt kennt, könnte mir hier besser helfen … Pirard ist imstande, mich zu schlagen, wenn er nur den Namen meines Verbrechens hört…«
Der Geist Tartüffs kam Julian zu Hilfe. »Die Sache ist ganz einfach! Ich gehe zu ihm zur Beichte!«
Dies war das Endergebnis seines Hin-und Herüberlegens, nachdem er zwei Stunden lang im Garten auf und ab gegangen war. Daran, daß er erschossen werden könnte, dachte er nicht mehr. Todmüde suchte er sein Zimmer auf.
Am andern Tage war er in der Morgenfrühe bereits mehrere Wegstunden zu Pferd vor Paris. Als er vor dem gestrengen Jansenisten stand, bemerkte er erstaunt, daß dieser durch sein Geständnis nicht besonders überrascht war.
Eher bekümmert als erzürnt, meinte der Pfarrer: »Ich bin wohl selbst mit an der Sache schuld. Ich habe das so kommen sehen; aber aus Freundschaft für Sie Unglückskind habe ich es nicht über mich gebracht, den Vater zu warnen…«
»Was wird er tun?« fragte Julian lebhaft.
In diesem Augenblicke liebte er den Abbé. Eine heftige Auseinandersetzung wäre ihm schmerzlich gewesen.
»Ich sehe drei Möglichkeiten«, fuhr er fort. »Erstens: der Marquis kann mich aus der Welt schaffen lassen…«
Er erzählte von seinem Selbstmordbriefe, den er Herrn von La Mole zurückgelassen hatte.
»Zweitens: mich durch Graf Norbert zum Duell fordern …«
»Würden Sie die Forderung annehmen?« unterbrach ihn Pirard, zornig aufstehend.
»Lassen Sie mich ausreden, Herr Pfarrer! Selbstverständlich werde ich niemals auf den Sohn meines Wohltäters schießen … Und drittens: kann er mich entfernen. Wenn er mir sagt: ›Gehen Sie nach New York! ‹ so gehorche ich. Dann kann man den Zustand von Fräulein von La Mole geheimhalten. Niemals aber werde ich zugeben, daß man meinen Sohn beseitigt.«
Читать дальше