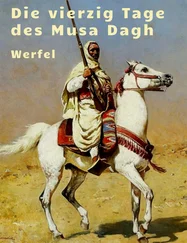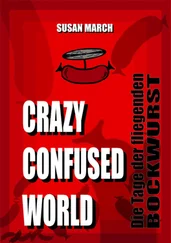Filiberto setzt sich zum Kranken aufs Bett. «Ein Arzt ist gekommen», sagt er und winkt Luciano heran. Ich laufe langsam zu Pedro Juan, er und seine beiden Gesprächspartner nicken mir zu, dann drehen wir uns alle vier dem Bett zu.
Luciano hat sich neben den Kranken gesetzt, gibt ihm die Hand, stellt sich ihm auf Englisch vor.
«Was hast du?», fragt er.
«Ich bekomme keine Luft», japst der Angesprochene, «ich fühle mich so elend, ich kann kaum auf den Beinen stehen.»
Die eine Gesichtshälfte des Kranken ist geschwollen und violett-rot, sein Haar nass geschwitzt.
Luciano nimmt seinen Unterarm, um den Puls zu messen: «Leidest du an Asthma?»
«Nein», stammelt der Kranke.
«Allergien?»
Er schüttelt den Kopf.
«Hast du einen Fiebermesser?», fragt Luciano.
«Dort, auf dem Tisch», sagt Filiberto, «aber wir haben schon gemessen. Über 40 Grad.»
Luciano befiehlt dem Asiaten, das Hemd auszuziehen. Er setzt sein Ohr an die verschwitzte Brust, der Kranke muss auf seinen Befehl hin tief einatmen, er schafft es kaum, er hustet, japst, röchelt. Luciano schaut ihm in den Mund, unter die Augenlider.
«Du hast eine starke Infektion der Lungen oder Bronchien», sagt Luciano und streicht dem Kranken übers nasse Haar, «aber ich bin kein Spezialist. Es ist besser, die Sache genauer abklären zu lassen.»
Er steht auf und wendet sich an Filiberto: «Ich denke, wir müssen ein Ambulanzboot kommen lassen, er muss ins Spital.» Filiberto nickt. «Der Mann scheint mir ernsthaft krank», fährt Luciano fort, «diese Art von Lungenkrankheit ist etwas ungewöhnlich. Ich bin kein Fachmann, aber die Atemnot ist bei Lungenentzündungen in der Regel nicht derart akut.»
Filiberto winkt Pedro Juan zu sich, gemeinsam verlassen sie den Raum.
Langsam kommt Luciano auf mich zu, seine Stirn in Falten, er scheint über etwas nachzugrübeln. Unmittelbar vor uns bleibt er stehen und sagt, leise, damit es der Kranke nicht hört: «Sein ganzer Rachen ist voller Eiter. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen.»
Kapitel II.
Am fünften Tag der Quarantäne bricht das dünne Eis, auf dem wir seit der Nacht auf Aschermittwoch alle gehen. Es ist, als ob die Schritte auf den Holzböden anders zu klingen, die Räume im Palazzo anders zu riechen und die Menschen um uns herum anders auszusehen begännen – wir sinken ab in klamme Angst. Gevatter Furcht, der ungebetene Gast, die ersten Tage noch höflich geduldet, zieht jetzt eine Spur blanken Entsetzens. Man kann es deutlich spüren, wenn immer man die Haut eines anderen berührt, wie ich jetzt die von Anna. Ich drücke ihre Hand auf den Stein, sie lässt die Nagelschere fallen, diese fällt ins Wasser der Lagune.
«Du sollst mir die Haare schneiden!», fordert sie mich nochmals zischend auf.
«Ich soll dir mit einer Nagelschere die Haare schneiden, was ist denn das für ein Unsinn?», erwidere ich.
«Dann mache ich es selber», sagt sie, bückt sich und sucht im untiefen Wasser nach der Schere.
«Lass deine Haare wie sie sind, verdammt, lass deine Haare wie sie sind», herrsche ich sie an und ziehe sie an der Schulter zurück. Sie zittert unter meiner Hand, ich getraue mich nicht, sie anzusehen, starre hinaus in die Lagune. Ich spüre, dass mein fester Griff sie nicht zu täuschen vermag – mir fehlt die Kraft, ihr jene Ruhe und Sicherheit zu vermitteln, die sie jetzt braucht. Woher soll ich diese Kraft nehmen, ich, der ein Leben lang nie stark war? Wie schaffen es Leute bloss, sich zu verankern, wirklich Halt zu finden, ihren Platz zu wissen und hinzustehen, fest wie ein Fels? Wie erlangt man sie, diese Gravitas? Kraft verkörpert meine Hand nun wirklich nicht: auf ihrer Schulter liegt eine verkrampfte Klaue, mit knochigen, viel zu langen Fingern, und Adern, die sich blutleer unter der Haut zu verstecken versuchen.
Nach einer Weile hört das Zittern ihrer Schulter auf. Sie setzt sich aufrecht hin und blickt den immer kleiner werdenden Wellen nach, welche sie im Wasser erzeugt hat. Ich bin froh, dass ich sie loslassen kann, um meine Arme vor der Brust zu verschränken. Natürlich ärgert sie meine Geste und so dreht sie sich zu mir um und fummelt mit der geretteten Nagelschere, die sie zwischen Zeigefinger und Daumen baumeln lässt, vor meinem Gesicht herum. «Willst du mich hypnotisieren?», frage ich leise. «Das bist du doch schon», gibt sie schnippisch zurück.
Als sie mir länger in die Augen blickt, nimmt ihr Ärger aber ab, und sie hört mit der Bewegung auf. Sie legt die Schere auf den Boden und rückt näher an mich heran.
Ich lege meinen Kopf auf ihren Rücken. Ihr Haar ist voller Blätter. Keine Ahnung, woher die stammen, der Herbst ist längst vorbei, im Gegenteil, Frühling wird es, oder sollte es werden, unsere Insel scheint gelähmt, auch der Boden, die Bäume, das Gras scheinen es zu spüren, die Vegetation scheint angehalten, kein einziges neues Blatt zeigt sich an den Ästen, obwohl es inzwischen Anfang März ist.
«Nur herumsitzen und warten, das macht mich völlig fertig», sagt sie. Sie rückt von mir ab und steht auf: «Komm, wir gehen ein paar Schritte, dann kommen wir vielleicht auf andere Gedanken.»
Sie reicht mir die Hand, um mir beim Aufstehen zu helfen, doch ich nehme sie nicht. Ich mag es gar nicht, an der Hand genommen zu werden, das sollte sie doch langsam wissen. Ich stütze stattdessen meine Handballen auf die Knie und drücke meinen Oberkörper nach oben, etwas verkrampft und vor allem allzu langsam, denn Anna nützt die Zeit, um bereits loszulaufen.
Ich blicke ihr ein paar Sekunden lang nach, beschleunige dann meinen Aufbruch und hole sie mit ein paar schnellen Schritten ein. Wir gehen nebeneinander auf dem Weg Richtung Marmortreppe, schweigend, ich die Hände in den Hosentaschen, sie die Arme lose an den Seiten baumelnd.
Am Ufer bei der Treppe stehen die Holzstämme immer noch Spalier; sie sind vom Feuer ausgehöhlt, in unterschiedlichem Mass freilich, einige sind fast bis zum Boden abgebrannt, andere nur oberflächlich angesengt. Anna steckt die Hände in einen der Stämme und zieht sie schwarz vor Russ wieder heraus. Sie hebt die schmutzigen Klauen, streckt sie mir entgegen und stösst ein tiefes «Buh» aus. Das Monster, das sie darstellen will, schürzt die Lippen und kommt auf mich zu, bereit, die Krallen in mein Fleisch zu schlagen. Kurz vor mir bleibt sie stehen, lächelt und legt dann ihren schwarzen Zeigefinger auf meine Wange. Zwei Striche malt sie auf mein Gesicht, auf jeder Seite einen, der Russ dürfte auf meiner bleichen Haut einen besonders hässlichen Kontrast bilden.
Sie lässt mich stehen mit meiner Kriegsbemalung, schlüpft an mir vorbei und schreitet die Marmortreppe hinab bis ans Wasser. Auf der untersten Stufe geht sie in die Knie, senkt die Hände ins Wasser und wäscht den Schmutz ab.
Ich folge ihr bis zur Mitte der Treppe und setze mich auf eine der Stufen. Sie dreht sich um, sieht mich an und zottelt zu mir hin, im Näherkommen trocknet sie die Hände an ihren Hosen ab. Das Kleidungsstück gehört einem unbekannten Gast aus den Vorjahren, der Stoff riecht nach Mann, richtig muffig. Die Hose stammt aus einem der Schränke im obersten Stockwerk unseres Palazzo. Dort hat Filiberto die Kleider gesammelt, welche die Gäste nach den Carneval-Festivitäten der vergangenen Jahre jeweils zurückgelassen oder vergessen hatten.
Die Kleiderpracht wurde gestern verteilt, Filiberto stellte sich ans Geländer der Holztreppe und warf den Leuten Hemden, Blusen, Hosen, ja sogar Hüte und Schuhe zu – das Rudel hungriger Tiere nahm die Gaben gerne in Empfang. Er schien sein Tun zu geniessen, er macht aus allem ein Ritual, minutenlang segelten Kleidungsstücke hinunter, genüsslich langsam liess er sie aus seinen Händen gleiten. Es war für viele wie Manna in der Wüste, denn nicht wenige waren nur leicht bekleidet an das Fest gekommen, in der Überzeugung, der Wein und die Geselligkeit würden genügend Wärme spenden für die zu erwartenden paar Stunden bis zur Rückkehr ins behagliche Zuhause, weit weg von dieser vermaledeiten Insel der Bertozzis. Die Stadt hat uns zwar versprochen, Kleider zur Verfügung zu stellen, doch bis jetzt ist nur eine Lieferung von Armeematratzen und Wolldecken eingetroffen.
Читать дальше