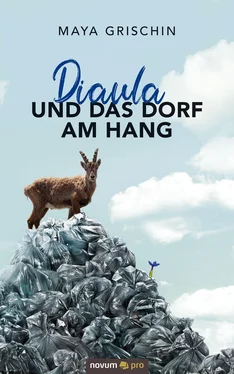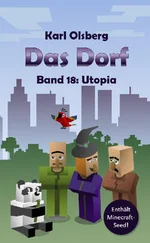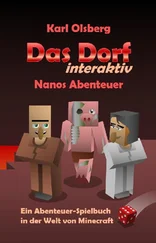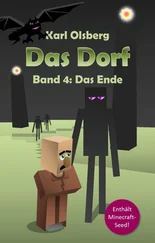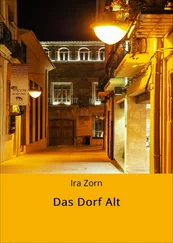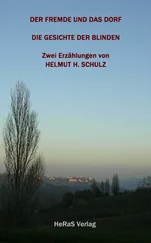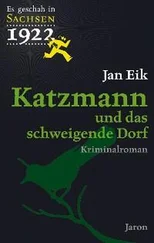Eine dritte Art von Zuständen, die Teilhard mir zu ergründen auftrug, nämlich meine eigenen Träume, Vorbilder, Ziele und Ängste mit denen der Einwohner von Devonn zu vergleichen. Dies ist wohl die schwierigste Aufgabe! Da könnte mir vielleicht Kollegger, der intuitive Beobachter, weiterhelfen. Also auf nach Devonn.
Devonn, einen Tag nach meiner Ankunft, in der Crousch alva
So bin ich denn, an einem strahlenden Sommertag in alller Herrgottsfrühe, wieder in Chur in die Rhätische Bahn gestiegen, den Zug, der mich bis nach Castelava brachte.
Süßer, melancholischer Heugeruch wehte durch die offenen Fenster. Zu meinem Leidwesen sind Mohnblumen und Kornblumenblau an den Feldrändern fast ausgestorben, es gibt kaum mehr Unkraut auf den wenigen noch bebauten Äckern. Die blauen Kerzen der Lupinen und die weißen Ackerwinden wucherten keck an den Bahndämmen. Heckenrosen dazwischen. Aber auch sie werden bald der chemischen Schädlingsbekämpfung zum Opfer fallen und in ein paar Jahren ausgerottet sein. An Straßenrändern staubbedeckte Wiesensalbei in der schläfrigen Langeweile des Sommers, zusammen mit den letzten nickenden Akeleien und Margeriten. Die Spitzenköpfchen des Wiesenkerbels schüttelten sich eitel und Butterblumen glänzten auf der Vorbeifahrt, Himbeeren und Brombeeren reiften klandestin an den Zäunen. Der Zug hetzte an zahllosen brachliegenden Feldern und den Stationen kleiner Dörfer mit klangvollen Namen vorbei, hielt nicht mehr auf verträumten Bahnhöfen, die Fenster und Balkone einst so schön mit Hängenelken geschmückt. Die Gebäude standen beschämt schlotternd leer. Kein Stationsvorstand trat mehr mit der Kelle aus der Tür. Die Fassadenfarbe der heruntergekommenen Bahnhöfe ist abgeblättert, die Fensterscheiben sind längst eingeschlagen. Vor den Türen mit Vorhängeschlössern faulten große Müllhalden. Auf zerbrochenen Sofas lümmelten sich der Moder und die Verlassenheit.
Ich stieg ins gelbe Postauto um und kam eine Stunde später in Devonn an. Den verwitterten Bildstock am Dorfeingang suchte ich leider vergebens, hörte aber das vertraute Läuten von grasenden Kühen auf der Wiese am Hang. Was hat sich alles im Dorf verändert? Das Erste, was in die Augen fällt, ist das klotzige Gebäude, die Klinik Huggentoblers auf der Allmend unterhalb des Dorfes. Bei meinem letzten Besuch war sie noch nicht einmal im Bau. Das verträumte Bauerngärtchen vor Großmutters Haus fehlt, ebenso die Holzbeigen an den Wänden. Auch den hinteren, uralten Teil unseres Hauses, mit dem zusammengebrochenen Ziegenstall, gibt es nicht mehr. Ein Hund bellte, es könnte einer von Wilhelm Tells Schäferhunden gewesen sein. Zwei Katzen räkelten sich auf dem Rücken in der Sonne. Ich hörte eine Motorsäge vom Waldrand und den Wind im alten Ahorn vor dem Gemeindehaus rauschen. Irgendwo spielte einer Klarinette. Die Melodie brach ab, setzte wieder an und stolperte über falsche Töne. So ging es eine ganze Weile. Ist Wittgenstein wieder in Devonn? Ist er es, der irgendwo in einem Gaden wie besessen auf seiner Klarinette übt?
Die Gerüche von warmem Roggenbrot aus dem Gemeindebackofen, von frisch gesägtem Holz, von Miststöcken, Schweinestall und Katzenpisse schwängern nicht mehr die Luft. Das Dorf riecht nach gar nichts mehr. Vornehm und stolz wie ein Engadinerdorf sieht Devonn jetzt aus! Alle Hausruinen sind verschwunden. Die Straßen sind asphaltiert. Die alten Häuser zeigen sich im Sonntagsstaat. Die Wände sind frisch geweißt und die Dächer neu mit Ziegeln oder mit glänzenden Schieferplatten gedeckt. Die Sgraffiti der Fassaden sind sauber hergerichtet, aber hinter den Häusern häuft sich in schwarzen Plastiksäcken der Müll und wartet darauf, heimlich in die Berge verfrachtet zu werden.
Ein hässlicher Hotelkasten und ein Dutzend neue Ferienhäuser kleben am Hang rechts oberhalb des Dorfes; so auch die zwei gespenstischen, nachts violett leuchtenden Gewächshäuser des Holländers Derk Vandemeer de Boer. Es gibt im ganzen Dorf kaum noch Miststöcke und frei herumlaufende, gackernde und pickende Hühner. Die großen Geflügelfarmen im Unterland haben das Hühnerhalten auch in Devonn unnötig gemacht. Eier sind billig wie noch nie. (Das erzählte mir der alte Calonder, den ich als Ersten traf. Er hat die Pfeife beim Reden nicht mehr aus dem Mund genommen.) Ein letzter Bauer hat einen Schweinestall, weit unten am Hang. Viele Wiesen werden nicht mehr gemäht, da es sich nicht mehr lohnt. Die Mähmaschinen und Erntedrescher verrosten in den Scheunen. Es gibt noch ein paar kleine Kartoffeläcker unterhalb der Kirche. Ziegenbauern gibt es nur noch einen. Jöri ist sich selber treu geblieben, hat noch den Stall voller Geißen und verkauft ihre Milch an die große Käserei im Tal. Der Bauer Bezzola hält jetzt eine große Schafherde. Man sieht die Tiere als weiße Punkte an den Steilwiesen des Piz Mulatsch grasen. Die windschiefe Hütte vom armen Clavadetscher klebt noch immer hoch oben am Hang bei der Rüfe. Tagsüber ist das Dorf wie ausgestorben. Viele Männer arbeiten auswärts, die Kinder sind in der Ferienkolonie, auf der Alp oder im Schwimmbad. Die Alten hängen den ganzen Tag mit Bier vor dem Fernseher. Ich begegne nur wenigen Frauen, die beim Einkaufen Zeit für einen Schwatz haben. Von Hedwig Tell höre ich, dass der alte Devonas gestorben ist und Alexa, meine Nachbarin, sich bald im Kantonsspital einer Knieoperation unterziehen muss.
Vor fast jeder Tür steht neben einem Pick-up ein Mercedes oder ein Sportwagen. Die meisten in Devonn scheinen jetzt Geld zu verdienen wie noch nie zuvor. Zu Ferienhäusern ausgebaute Ställe werden sommers und winters an Gäste vermietet, ebenso Alpen und Wiesen. Es werden Schnitzereien und Möbel aus Arvenholz an Gäste verhökert, Handgewobenes, gestrickte Socken, Jacken und Postkarten, Kräuter, neben Schlüsselanhängern auch Trockenfleisch und geräucherte Würste. Nur die steilen grünen Hänge und die Wälder, die Felsen und Bergspitzen scheinen die alten geblieben zu sein, tröstlich unverändert, in einer sich ständig verändernden Welt.
Ich gehe gemächlich an die Aufgabe, die mir Hochwürden gestellt hat. (Ich brauche dafür keinen Aleph, wie ihn Jorge Luis Borges in seiner Geschichte Der Aleph beschrieben hat – einen magischen Punkt auf der neunzehnten Stufe einer schmutzigen Kellertreppe in Buenos Aires, womit man alles in der Welt gleichzeitig, aus allen Richtungen, sehen kann, Raum und Zeit gleichermaßen. Das hatte ich Teilhard bereits mitgeteilt. Er muss Geduld mit mir haben. Wenn mich etwas fesselt – es kann für andere etwas ganz Unwichtiges sein – bleibe ich lange stehen und lasse mich darauf ein.)
Mir fällt wieder Parmenides ein. Was hat er mir damals auf Sbloc klarmachen wollen? Dem Einen, und nicht der Vielfalt zu trauen? Das Gleichgewicht in der Gegenwart zu suchen? Das geschieht manchmal beim Kochen, beim Fliegen und vor allem, wenn ich mit Kollegger im Wald sitze oder mit ihm am Flipperkasten stehe. Das hätte Parmenides sicher gerne von mir gehört. Aber wo, wo ist Kollegger?
Jedenfalls wünscht Teilhard, dass ich über die Vergangenheit der Dorfgemeinschaft Bescheid weiß, um die Gegenwart, die mich oft mit Melancholie erfüllt, richtig verstehen zu können. Aber jetzt bin ich hier, und weiß nicht, wo Kollegger ist.
In Großmutters Haus, einen Tag später
Als es tagte, machte ich einen heimlichen Erkundungsflug. Mit gutem Aufwind schwebte ich über das Orchideenhaus von Vandemeer de Boer, der mit einer dampfenden Tasse vor der Tür stand, flog über die Klinik Huggentobler, deren große Fensterfronten in der Morgensonne leuchteten, übers neue Gemeindehaus und das Schulhaus, Wilhelm Tells Kartoffelacker bis hin zur Glasbläserei, wo Huonder bereits an der Arbeit war. (Er bläst heutzutage nur noch Glasgefäße für die chemischen Werke in Ems.) Die seit Jahren verlassene und verfallende Mühle ist von Brennnesseln, Hahnenfuß und einer Armee blauem Eisenhut umzingelt. Das Mühlrad liegt verschlammt im ausgetrockneten Bachbett. Das Haus des Kommunisten Wettstein daneben steht leer und soll abgerissen werden. Der umtriebige Schriftsetzer ist wahrscheinlich arbeitslos geworden, denn viele lokale Zeitungen erscheinen nicht mehr.
Читать дальше