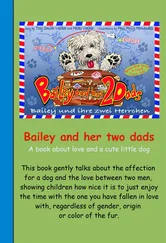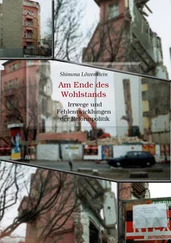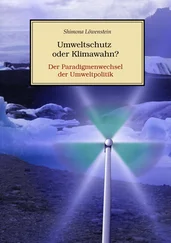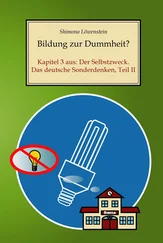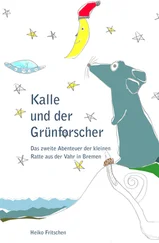1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 In Bezug auf die Prävention von jugendlichem Risikoverhalten werden ambivalente Auswirkungen herausgestellt. Sportvereinsmitglieder haben demnach einen höheren Alkoholkonsum, jedoch niedrigeren Nikotinkonsum als Nicht-Mitglieder. Auch in Bezug auf deviantes Verhalten können keine signifikanten Unterschiede zwischen Vereinsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern festgestellt werden (Brettschneider & Kleine, 2002).
Auf die Bedeutung des organisierten Sports zur Gemeinwohlorientierung wird nicht näher eingegangen, hier sei u. a. auf eine Zusammenstellung von Forschungsergebnissen bei Rittner & Breuer (2004, S. 50f), den Sportentwicklungsbericht 2015/16 (Breuer, 2017, S. 244f), Tiemann (2012, S. 271ff) und Opper & Wagner (2009, S. 11) verwiesen. Zur Zukunft der Sportvereine in zunehmend pluralisierten Sportlandschaften äußern sich Braun und Hansen (2019) kritisch.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der organisierte Sport das Potential besitzt, unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen. Michels (2007; siehe auch Welsche, 2013/2018c) u. a. weisen allerdings darauf hin, dass die Arbeit in Sportvereinen, hauptsächlich in ehrenamtlichen Strukturen von Laien geleistet wird und von professioneller Sozialer Arbeit klar abzugrenzen ist. Unterschiede beider Felder sind zu wahren, Kooperationen zwischen den Beteiligten werden jedoch gewünscht, um gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen (Welsche, 2018c, S. 79).
Schulsport nimmt im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrags von Schulen in Deutschland einen bedeutenden Stellenwert ein. Die »leibliche Verfasstheit des Menschen und die Bewegungskultur des Sports als Medium leiblicher Erfahrungen« (Schulz, 2014, S. 178) bildet dafür einen wichtigen Grundstein, innerhalb dessen Bewegung, Spiel und Sport als elementare Bestandteile ganzheitlicher Bildung verstanden werden. Daher wird Schulsport auf unterschiedlichen Ebenen im Kontext Schule berücksichtigt. Auch die Schulgesetze tragen dem Rechnung und erheben Sport und Gesundheit zu unverzichtbaren Erziehungszielen. Im Schulgesetz Berlin heißt es z. B.:
»Schulische Bildung und Erziehung sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere befähigen, […] ihre körperliche, soziale und geistige Entwicklung durch kontinuierliches Sporttreiben und eine gesunde Lebensführung positiv zu gestalten sowie Fairness, Toleranz, Teamgeist und Leistungsbereitschaft zu entwickeln« (Sen BWF, 2010, § 3 (3) 7).
Neben dem obligatorischen Unterrichtsfach Sport, welches in allen Schulformen und -stufen fest im Schulplan verankert ist, umfasst der Begriff Schulsport auch weitere Formen von Sport, Spiel und Bewegung, die im Kontext Schule stattfinden und dazu beitragen, pädagogische Aufgaben und Ziele in der Schule zu erfüllen (Bräutigam, 2008, 18). Fessler (2010) hat eine Ordnung vorgenommen, die eine hilfreiche Übersicht zu der Vielfalt an Schulsportangeboten gibt. Er unterscheidet nach (1) unterrichtlichem Schulsport, (2) außerunterrichtlichem Schulsport, (3) zusätzlichen Sport-, Spiel-, und Bewegungsangeboten in der Schule sowie (4) schulsportlichen Angeboten mit/durch außerschulische Partnerorganisationen. Je nach Ausrichtung und Grad der Schulsportkultur können in einer Gesamtstrategie bewegungszentrierte Schulprofile geschaffen werden (Stibbe, 2014, S. 110ff). Der Sportsozialarbeit kommt v. a. im außerunterrichtlichen Schulsport und bei weiteren nicht-obligatorischen Angeboten eine besondere Rolle zu (  Abb. 4).
Abb. 4).
Abb. 4: Bausteine des Schulsports, (aus: Fessler, N. (2010). Schulsportliche Profilbildungen: Eine Einführung. In: N. Fessler, A. Hummel & G. Stibbe (Hg.), Handbuch Schulsport (S. 355–358). Schorndorf: Hofmann, hier S. 356)
2.3.1 Unterrichtlicher Schulsport
Schulsportunterricht erhält durch landeseigene Rahmenlehrpläne und -richtlinien seine Konkretisierung. Er wird mit durchschnittlich zwei bis drei Schulstunden pro Woche unter der Leitung einer akademisch ausgebildeten Sportlehrkraft an allen Schulformen verpflichtend durchgeführt. Dabei wird Sportunterricht im Klassenverband, in Kursform, koedukativ oder geschlechtergetrennt unterrichtet. Schulsport nimmt eine besondere Stellung ein, da er der einzige obligatorische Sport für alle Kinder und Jugendlichen ist (DOSB, 2009).
Kenntnisse schöpft der Schulsportunterricht mehrheitlich aus der Sportpädagogik und -didaktik ( Kap. 6.1). Konkrete Ziele, Aufgaben und Inhalte ergeben sich v. a. aus den Richtlinien staatlicher Bildungspolitik und -verwaltung. Für die Koordinierung länderübergreifender Angelegenheiten im Bereich des Schul- und Hochschulsports ist die Kultusministerkonferenz (KMK) zuständig. In den Ländern liegt die Zuständigkeit bei den Bildungs- bzw. Wissenschaftsministerien. Landesspezifische Rahmenlehrpläne dienen dabei als Grundlage für die Ausgestaltung des Sportunterrichts an den jeweiligen Schulstandorten. Auch die eigene sportliche Biographie der Schulleitung, der Lehrkräfte und des weiteren pädagogischen Personals an Schulen beeinflussen die inhaltliche Gestaltung des Schulsportunterrichts (Schulz, 2014, S. 178f; Laging, 2003, S. 546).
Leitidee und Legitimierungsgrundlage für den Schulsport war seit den 1990er Jahren der Gedanke des erziehenden Sportunterrichts nach Balz (1992). Im Sinne eines Doppelauftrags (Erziehung zum und im/durch Sport) hat dieser Gedanke in Lehrpläne Einzug gefunden (Prohl, 2010, S. 176f). Vorreiter war das Land NRW, dessen fachdidaktischer Konsens bundesweite Verbreitung fand.
Im Zuge enttäuschender Ergebnisse bei internationalen Leistungsvergleichsstudien wie z. B. PISA 2000 wurden Bildungsstandards und Kompetenzen als Allheilmittel einer neuen Unterrichtssteuerung angepriesen, die u. a. eine bessere Kontrolle der Lernergebnisse begünstigen sollen (Aschebrock & Erlemeyer, 2014, S. 204f). Neuerdings trifft daher der erziehende Sportunterricht auf das Konzept kompetenzorientierter Kernlehrpläne. Diese Kompetenzwende löste heftige Kritik v. a. unter Sportpädagogen und -pädagoginnen aus, da man befürchtete, dass bisherige Grundsätze des erziehenden Sportunterrichts verloren gingen. Einige Sportwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen verweisen in diesem Kontext darauf, dass sich kompetenzorientierte Standards im Schulsportunterricht häufig auf sportmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten beschränken. Die kognitiven, sozialen, emotionalen und motivationalen Dimensionen sportlichen Handelns würden dabei kaum berücksichtigt, was in einen geschmälerten Bildungsanspruch des Schulsports münden könne. Auch fehle es meist an konkreten Hinweisen und Konzepten zur Unterrichtsgestaltung (ebd.; auch Ruin & Stibbe, 2014, S. 172). Aschebrock & Erlemeyer (2014, S. 204f) sehen jedoch durchaus auch Anknüpfungspunkte von kompetenzorientierten Kernlehrplänen an bestehende Konzepte des erziehenden Sportunterrichts und an etablierte pädagogische Prinzipien und Perspektiven.
Ergebnisse einer umfassenden Studie zum Schulsport (SPRINT, 2006) unter der Leitung von Brettschneider zeigen, dass der Sportunterricht Nachholbedarf hat, was sich an einigen Themen festhalten lässt. Als kritisch herausgestellt wurden u. a. die vermehrte Durchführung von fachfremd erteiltem Unterricht. Auch wird von hohem Unterrichtsausfall, z. T. durch Mangel an Sportstätten oder nicht adäquater Vertretung, berichtet (Heim et al., 2006, S. 68ff). Ergebnisse stellten außerdem eine soziale Selektivität in der Teilhabe am Sportunterricht fest. Schüler und Schülerinnen der Hauptschulen seien laut einer Zusammenfassung der SPRINT Studie
»dabei dreifach benachteiligt: Sie erhalten den geringsten Umfang an Sportunterricht, dieser wird in größerem Umfang als an anderen Sekundarschulen fachfremd unterrichtet und sie treiben in der Freizeit und im Verein weniger Sport« (Gerlach et al., 2006, S. 118).
Читать дальше
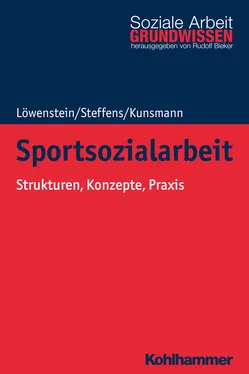
 Abb. 4).
Abb. 4).