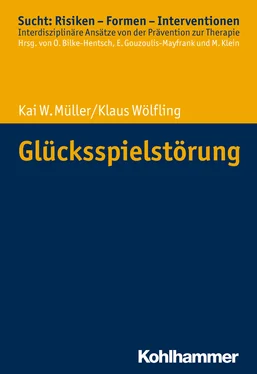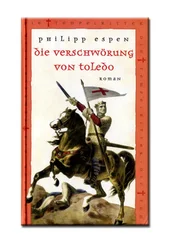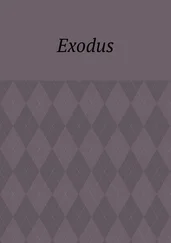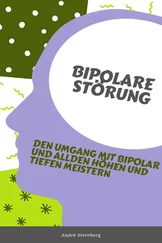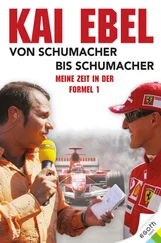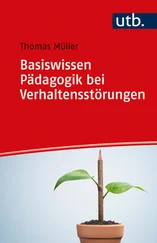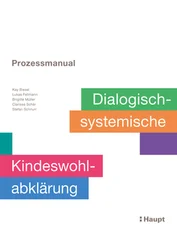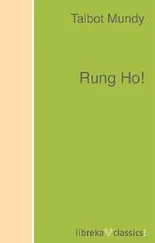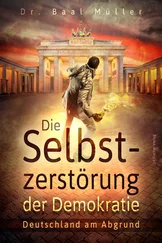2.1.1 Prävalenz der Glücksspielstörung im Jugendalter
Die meisten großen Prävalenzstudien zum Glücksspielverhalten in Deutschland betrachten Jugendliche nur im Rahmen einer Teilauswertung. Gleichzeitig wird deutlich, dass verschiedene Studien immer wieder auf eine Risikoerhöhung für Glücksspielprobleme unter jüngeren Befragungsteilnehmenden hinweisen (Meyer et al. 2011; BZgA 2014). Folglich stellt sich mit Recht die Frage nach dem Problemausmaß speziell unter Minderjährigen.
Internationale Studien weisen teils deutlich höhere Prävalenzraten unter Jugendlichen nach, als wir sie im Erwachsenenalter finden (Forrest und McHale 2011; Valentine 2008; Blinn-Pike et al. 2010). Für Deutschland liegen gegenwärtig nur die Daten aus drei gesonderten Studien an Jugendlichen vor. Im Jahre 2001 konnte die Forschergruppe um Hurrelmann (2003) bei der Befragung von knapp 5.000 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren eine Prävalenz von 3 % nachweisen. Knapp zehn Jahre später folgten repräsentative Erhebungen an 3.795 Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz, sowie 5.514 in Nordrhein-Westfalen (Giralt et al. 2018). Die beiden parallelisierten Studien integrierten unterschiedliche Variablen, um dem vermuteten multifaktoriellen Bedingungsgefüge gerecht zu werden. Für die zusammengefassten Stichproben ergab sich eine 12-Monats-Prävalenz von 1,7 und 2,2 % mit weiteren 3,4 bzw. 3,9 %, deren Glücksspielnutzung als riskant einzustufen ist. Es konnte überdies nachgewiesen werden, dass ein überraschend hoher Anteil von 54 % der Minderjährigen bereits regelmäßig an kommerziellen Glücksspielen teilgenommen hatte, obgleich dies eigentlich vom Gesetzgeber verboten ist. So gaben 16 % der Minderjährigen an, bereits in Spielotheken Geldspielautomaten genutzt zu haben. Die Teilnahme an internetbasierten Glücksspielen wurde, je nach Form des Online-Glücksspiels, von 4 bis 17 % der Jugendlichen bejaht. Beide Prozentzahlen stimmen nachdenklich, ergaben die Analysen derselben Studie doch, dass das Spielen an Geldspielautomaten sowie die Nutzung von Online-Glücksspielen signifikant mit dem Risiko für ein problematisches Nutzungsverhalten einhergingen.
2.1.2 Migrationshintergrund und Glücksspielstörung
Im klinischen Kontext erweist sich immer wieder, dass ein erheblicher Teil jener Patientinnen und Patienten, die sich wegen einer Glücksspielsucht in Behandlung begeben, einen Migrationshintergrund aufweisen. Auch eine systematische Übersichtsarbeit von Williams et al. (2012) verdeutlicht enge Zusammenhänge zwischen pathologischem Glücksspiel und Migrationshintergrund. Interessanterweise bleiben diese Zusammenhänge auch dann stabil, wenn für demografische Faktoren (etwa sozioökonomischer Status oder Bildungsgrad) oder die bevorzugt genutzte Glücksspielform statistisch kontrolliert wird (Hass et al. 2012; Volberg et al. 2001; Kastirke et al. 2014). Auch in der bereits zuvor vorgestellten PAGE-Studie wurden die Zusammenhänge zwischen dem Migrationshintergrund und Symptomen einer Glücksspielstörung untersucht (Kastirke et al. 2014). Überraschenderweise ergaben die Auswertungen, dass Personen mit einem direkten oder indirekten Migrationshintergrund insgesamt gesehen seltener an Glücksspielen teilnahmen. Unter gesonderter Betrachtung einzelner Glücksspielarten kehrte sich dieser Trend jedoch um: Die Nutzung von Geldspielautomaten sowie Sportwetten (online wie offline), Spielformen also, die überzufällig häufig mit Symptomen des pathologischen Glücksspiels einhergehen, war unter Personen mit Migrationshintergrund deutlich verbreiteter. Entsprechend lag die Prävalenz für eine suchtartige Glücksspielnutzung bei Personen mit einem Migrationshintergrund (1,8 %) signifikant über jener der übrigen Befragten (0,7 %). Ein vorhandener Migrationshintergrund erhöhte das Risiko für die Erfüllung von Kriterien des pathologischen Glücksspiels um 143 %. Auch in dieser Studie wurde der Frage nachgegangen, ob diese Zusammenhänge gegebenenfalls über die Einflüsse dritter Variablen erklärbar sein könnten. Dem war nicht so: Nach Kontrolle demografischer Merkmale betrug die Risikoerhöhung noch immer 103 %, und 98 %, nachdem auch noch für die bevorzugte Glücksspielform kontrolliert worden war.
Der Migrationshintergrund stellt also einen unabhängigen Risikofaktor für eine Glücksspielstörung dar, doch woran liegt das? Der Prozess des Migrierens in einen anderen Kulturkreis, in welchem spezifische, für Migrierende nicht sofort vertraute, kulturelle Codes (Sprache sowie einzelne kulturelle Gepflogenheiten, wie etwa Humor oder nonverbale Kommunikationsformen) enthält, kann zunächst als ein klassischer psychosozialer Stressor aufgefasst werden. Die Eingewöhnung an die neue Situation, das Zurechtfinden in der neuen Umgebung sowie die vorausgegangene psychosoziale Entwurzelung oder gegebenenfalls dramatische, vielleicht gar traumatische Umstände, die zu der Migration geführt haben mögen, stellen hohe Anforderungen an die Anpassungsleistung. In der interkulturellen Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang von bestimmten Akkulturationsstrategien, die Migrierende (unbewusst) anwenden, um sich an die neue Kultur bzw. die neuen Umstände anzupassen. Je nachdem, wie gut diese Anpassungsleistung gelingt, vermindert oder erhöht sie die mit der Eingewöhnung verbundene Stressbelastung. Im Falle einer wenig optimalen Anpassung mag die Teilnahme an Glücksspielen, noch dazu in spezifischen »soziokulturellen Nischen«, wie man sie in Spielotheken und Sportwettbüros mit ihren wiederum eigenen subkulturellen Gepflogenheiten sehen kann, begünstigt werden und zudem den Charakter einer dysfunktionalen Copingstrategie erhalten (Blaszczynski und Nower 2002; Fong 2005a). Durch die folgende Anbindung an neue soziale Interaktionspartner innerhalb dieser Spielotheken und Wettbüros wird zudem das Bedürfnis nach sozialer Affiliation gestillt, was einen weiteren begünstigenden Faktor für die Fortführung der Glücksspielteilnahme bedeuten kann.
Dass die spezifische Art der angewandten Akkulturationsstrategie von Bedeutung ist, wird auch durch eine Studie zur Glücksspielnutzung deutscher Jugendlicher unterstrichen (Giralt et al. 2018). Hier wurden per Fragebogenerhebung spezifische Formen der Akkulturation erhoben. Die Datenauswertung ergab, dass Jugendliche mit einer problematischen Nutzung von Glücksspielen überzufällig häufig die Akkulturationsstrategien Marginalisierung und Separation aufwiesen. Unter Marginalisierung versteht man das völlige Aufgeben von kulturellen Werten und Eigenarten des Herkunftslandes bei gleichzeitiger Ablehnung ebensolcher Werte und Eigenarten des neuen Kulturraums. Separation bedeutet die Beibehaltung der kulturellen Normen des Herkunftslandes, jedoch die gleichzeitige Ablehnung der Kultur des Einwanderungslandes. Beide Formen der Akkulturation werden als eher dysfunktionale Anpassungsleistungen beschrieben und stehen mit einer erhöhten Stressbelastung für die betreffende Person in Zusammenhang.
2.2 Befunde aus Längsschnittstudien und Katamneseerhebungen
Anhand epidemiologischer Erhebungen lässt sich zwar die Prävalenz einer Glücksspielstörung in der Bevölkerung abschätzen, jedoch erlauben sie nicht, Aussagen über deren zeitliche Stabilität zu treffen. Es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, über diese Stabilität Bescheid zu wissen. Wäre die Glücksspielstörung ein flüchtiges Phänomen, das nach kurzer Zeit vollständig remittiert, würde dies die Frage aufwerfen, ob es überhaupt notwendig ist, aufwändige Psychotherapieforschung zu betreiben, das Hilfesystem auszubauen oder ehrgeizige Präventionskonzepte zu installieren. Neben diesem eher grundsätzlichen Aspekt liefern Informationen über typische oder atypische Symptomverläufe Anhaltspunkte, um Faktoren zu erkennen, die eine Symptomatik exazerbieren lassen oder eben abmildern.
Читать дальше