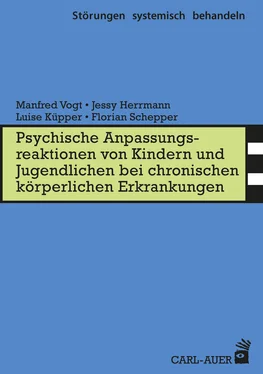Wir geben in unseren Fallbeispielen einen Einblick in sehr unterschiedliche, das therapeutische Vorgehen beeinflussende Versorgungssettings, in denen systemisch orientierte psychotherapeutische und psychosoziale Begleiter tätig sind: von der ambulanten systemisch-lösungsfokussierten Therapie und Beratung bis hin zur stationären Versorgung auf einer pädiatrisch-onkologischen Station. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der regionalen Versorgungsstrukturen können unsere Darstellungen jedoch lediglich exemplarischen Charakter haben.
Zu verschiedenen Zeitpunkten einer Erkrankung finden vielfältige somatische, psychosoziale und psychotherapeutische Behandlungen statt. Dabei kann es sich um hoch formalisierte Interventionen (ambulante und stationäre, singulär vereinbarte Therapietermine wie zum Beispiel das psychoonkologische Anamnesegespräch zur Auftragsklärung), um halb formalisierte Interventionen (bedarfsgerechte, therapiebegleitende Gespräche während eines Klinikaufenthalts oder einer Reha-Maßnahme) sowie um informelle Interventionen (singuläre Ad-hoc-Interventionen im Klinikalltag) handeln. Gerade der phasenhafte Verlauf chronischer Erkrankungen erschwert eine psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung im bestehenden System, wobei diese Versorgung sich eigentlich an diesem Verlauf orientieren müsste: Es gibt Zeiten, in denen Gespräche häufiger, teilweise hochfrequent notwendig sind und der Unterstützungsbedarf sehr groß ist. Demgegenüber gibt es Plateauphasen, in denen über einen längeren Zeitraum hinweg wenig Entwicklung stattfindet und oftmals auch der Beratungs- und Therapiebedarf sinkt. Abgesehen von der Erschwernis, dass in der Niederlassungspraxis der regulären Psychotherapie eine psychische Störung vorherrschen und diagnostiziert werden muss, erschwert es der phasenhafte Verlauf, psychotherapeutische Termine kontinuierlich und am besten regelmäßig zur gleichen Zeit wahrzunehmen, da dies die Möglichkeiten in der Alltagsrealität betroffener Familien oft weit übersteigt.
Wir haben deshalb entschieden, die dargestellten Interventionen, Fallbeispiele und Transkripte und den uns praktizierten systemischen Ansatz in der gesamten Krankheits- und Behandlungsperspektive einzubeziehen. Systemische Therapie aus dem Gesamtkontext zu isolieren, würde der Ganzheitlichkeit einer systemischen Therapieperspektive nicht gerecht.
Sprache in der systemischen Therapie und im Buch
»Störungen systemisch behandeln« bedeutet nicht, ein pathologieausgerichtetes Sprachverständnis in der Systemischen Therapie zu reanimieren, wie wir es aus der frühen Familientherapie kennen. Es war gerade ein Verdienst der frühen systemischen Konzepte, neue therapeutische Sprachspiele zu generieren, die zu einem paradigmatischen Wechsel hin zu einer ressourcenfokussierten Psychotherapie führten, in der der klinische Störungsbegriff in den Hintergrund trat. Symptombilder und klinisch-diagnostische Kategorien zu meiden, war bei vielen Praktikern identitätsstiftende Tradition innerhalb der Systemischen Therapie. Im psychotherapeutischen Alltag können wir klinisch behandlungswürdige psychische Anpassungsreaktionen jedoch auch nicht ignorieren. Und das Sprechen zu vermeiden, macht sie nicht besser.
In unserer Praxis verstehen wir »störungsspezifisches Wissen« als klinisches Erfahrungswissen und handlungsfeldbezogenes Praxiswissen. Dazu zählen sowohl das Wissen zu somatischen Erkrankungen als auch das Wissen zu Formen der Krankheitsbewältigung im Sinne einer emotionalen und kognitiven Verarbeitung der Krankheitsrealität, möglichen psychischen Anpassungsreaktionen und auch das Wissen um eine optimale Organisation des Krankheitsmanagements. Wir stellen folglich medizinische Therapien, psychotherapeutische Interventionen in den unterschiedlichen Krankheits- und Therapiephasen dar.
In unserem Grundverständnis Systemischer Therapie beziehen wir uns auf das Konzept der Salutogenese (Antonovsky 1993, 1997). Wenn wir von psychischen Anpassungsreaktionen und Verhaltensauffälligkeiten in der Folge chronischer körperlicher Erkrankungen sprechen, tun wir das im Sinne des Konzepts der »eingeschränkten Wahlmöglichkeiten« (Isebaert 2005) – der »anderen Seite der Gesundheit« (Simon 2012).
Am Beginn des ersten Teils dieses Buches stehen Überlegungen zur Perspektive der Zeit in ihrer Chronizität. Sodann wird der Fokus auf das medizinisch-klinische und psychologische Wissen ausgerichtet. Ausgewählte klinische Krankheitsbilder werden sowohl auf somatischer und medizinischer Ebene als auch mit den jeweils einhergehenden psychischen Belastungen, Folgen und Beeinträchtigungen für die Betroffenen und ihre Familien dargestellt. Im Anschluss wenden wir uns den relevanten, die psychosoziale Versorgung mitbestimmenden Rahmenbedingungen zu und fassen die Besonderheiten und Anforderungen an psychotherapeutische Interventionen bei der Behandlung psychischer Anpassungsreaktionen bei chronischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter zusammen. Dieser erste Teil des Buches erläutert also typische Krankheitsbilder und deren Verläufe sowie die damit einhergehenden Belastungen für die Klienten und die Herausforderungen für die ambulante und klinische psychotherapeutische Praxis.
Im zweiten Teil werden die zu bestimmten Zeitpunkten der Erkrankung notwendigen und nützlichen Interventionen skizziert. Um systemisch-lösungsfokussierte Interventionen in den Kontext bestehender Therapieschulen einordnen zu können, beginnen wir diesen Teil mit der Betrachtung des Themas chronischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus der Sicht der relevanten Therapieverfahren und deren Zugangsweisen. Darauf folgen die Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten von Psychotherapie unter besonderer Berücksichtigung einer systemisch-lösungsfokussierten Perspektive bei chronischen Erkrankungen aus verschiedenen konzeptionellen Blickwinkeln. Dazu skizzieren wir einen theoretischen, einen konzeptionellen, einen strukturellen und einen methodischen Arbeitsraum.
Bei den psychischen Folgeerscheinungen chronischer körperlicher Erkrankungen gilt es zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zur ambulanten systemisch-lösungsfokussierten Therapie beispielsweise aufgrund einer kindlichen Angststörung das Vorgehen im Krankheitsverlauf als zeitbedingte Intervention anzusehen ist. Aus diesem Grund stellen wir zu Beginn des dritten Teils des Buches unser Modell dynamischer Anpassungsleistungen an chronische körperliche Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter vor: Es bietet Praktikern einen Rahmen zur Reflexion, zu welchen Zeitpunkten im Krankheitsverlauf spezifische Interventionen nützlich sind und wie diese aufeinander bezogen werden können. Anhand von unterschiedlichen Fallbeispielen aus der ambulanten und stationären Praxis zeigen wir, wie Interventionen unter Bezug auf die Perspektive der Zeit in einem therapeutischpraktischen Vorgehen umgesetzt werden können. Wir berücksichtigen dabei sowohl ambulante psychotherapeutische Prozesse als auch psychologisch-therapeutische Begleitungen im stationären Kontext.
Die Bedeutung der Zeit in der Therapie
Die Zeit ist das umfassende Band aller Zusammenhänge.
George Kelly (1955, dt. 1986)
Der Begriff der chronischen körperlichen Erkrankung umfasst unterschiedliche Symptome und Krankheitsbilder, die durch ihren lang andauernden Verlauf und typische Erkrankungsphasen charakterisiert sind. Der Perspektive der Zeit kommt bei diesen Erkrankungen eine besondere Rolle zu: zum einen der Dauer einer Erkrankung, die sehr kurze, aber auch lange Lebenszeiträume und schließlich die gesamte Lebensspanne umfassen kann, zum anderen den unterschiedlichen Phasen im Verlauf.
Abb. 1: Chronos und Kairos
Die beiden Götter der Zeit, Chronos und Kairos (vgl. Abb. 1), versinnbildlichen zwei wesentliche zeitliche Dimensionen. Der griechische Gott Chronos steht für quantitativ gemessene Zeit: Er symbolisiert den Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, womit lange Zeitspannen und auch überdauernde oder lebenslange gesundheitliche Einschränkungen begrifflich erfasst werden können. Sie werden dann als chronisch bezeichnet. Demgegenüber steht der Gott Kairos – als religiös-philosophischer Begriff – für eine andere Zeitdimension, nämlich den günstigen Zeitpunkt für eine Entscheidung oder Handlung, der nicht ungenutzt verstreichen sollte. Eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen und zum entscheidenden Zeitpunkt zu handeln, kann im Zeitverlauf zu wichtigen Wendungen führen.
Читать дальше