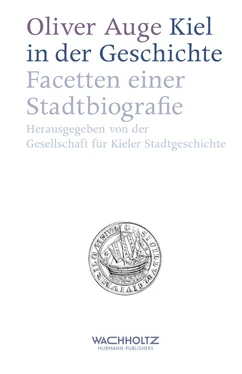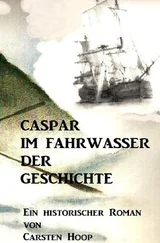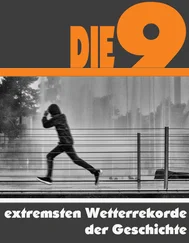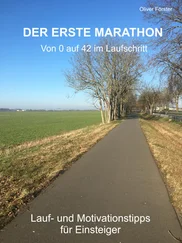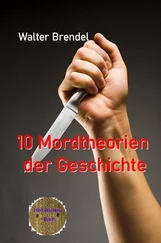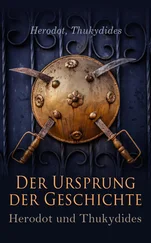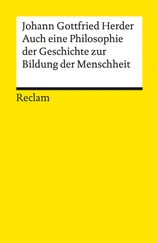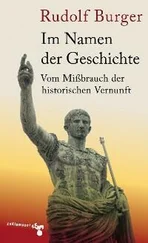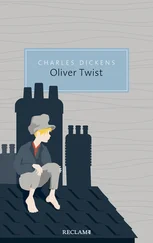Oliver Auge - Kiel in der Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Auge - Kiel in der Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kiel in der Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kiel in der Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kiel in der Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kiel in der Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kiel in der Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Pläne zu einer Rückverlegung des Oberpräsidiums nach Kiel wurden nun aber keineswegs fallengelassen, zumal die Stadt Kiel selbst Morgenluft witterte und ein lukratives Angebot unterbreitete: Die Stadt wollte ein kostenloses Grundstück für den Bau eines repräsentativen Oberpräsidiums zur Verfügung stellen und bis zu dessen Errichtung für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren auf ihre eigenen Kosten Räume im Stadtgebiet anmieten, um einen möglichst raschen Umzug nach Kiel bereits während der Bauzeit gewährleisten zu können. Zu diesem Angebot hatte man sich in Kiel entschlossen, da ein Wiedereinzug des Oberpräsidenten ins Kieler Schloss mittlerweile unmöglich geworden war. Hier residierte seit 1888 der Kaiserbruder Heinrich (*1862; †1929) mit seinem Hof. Als Umzugsdatum wurde der 1. Oktober 1907 vorgeschlagen. Der 1906/07 amtierende Oberpräsident Kurt von Dewitz (*1847; †1925) begrüßte die Initiative. Er hatte sich krankheitshalber einige Zeit in der Kieler Universitätsklinik aufhalten müssen und seinen Worten zufolge mehr hochgestellte Leute am Krankenbett empfangen als in seiner ganzen vorangegangenen Amtszeit in Schleswig. Insbesondere liebäugelte er mit einem attraktiven Grundstück zwischen der Förde und dem Düsternbrooker Gehölz für den Neubau. Hier herrschte ein sauberes Klima, und von hier aus konnte er die großen kaiserlichen Schiffe sehen. Um von dem damals noch etwas abgelegenen Standort schnell ins Zentrum zu gelangen, hatte er die Idee eines überdachten Motorbootes, mit dem er die längere Wegstrecke problemlos zurücklegen wollte. Doch verhinderte das Preußische Abgeordnetenhaus die Umsetzung all dieser Pläne mit seinem Beschluss vom 5. März 1907. Als Kompromisslösung schlug der nachfolgende Oberpräsident Friedrich von Bülow (*1868; †1936) eine Teilung des Regierungsbezirks Schleswig-Holstein vor, wonach die Etablierung eines zweiten Regierungssitzes in Kiel möglich geworden wäre. Aber auch diese Idee stieß im Abgeordnetenhaus auf Ablehnung: Man fürchtete, einen Präzedenzfall zu schaffen, auf den sich andere preußische Regierungsbezirke berufen könnten. Vor allem aber hätte die Umsetzung dieser Kompromisslösung das schleswig-holsteinische Selbstverständnis im Kern erschüttert, verstand man sich hier doch bekanntlich als »up ewig ungedeelt«.
Erst der Erste Weltkrieg brachte Bewegung in diese verfahrene Angelegenheit. Kriegswichtige Zentralbehörden wie die Provinzialkartoffelstelle, die Provinzialfettstelle, die Provinzialeierverteilungsstelle oder die Provinzialfuttermittelstelle waren im zentralörtlichen Kiel, nicht im abgelegenen Schleswig eingerichtet worden. Diese Stellen unterstanden dem Oberpräsidenten, der jetzt immer häufiger nach Kiel reisen musste, um sie zu lenken, was eine nicht immer ganz unproblematische Aufgabe darstellte. Der Weg nach Kiel war nicht ohne weiteres zu bewältigen, denn ein eigenes Kraftfahrzeug stand für diese Fahrten nicht zur Verfügung, und der Eisenbahnverkehr zwischen Kiel und Schleswig war kriegsbedingt massiv reduziert. Um hier zu einer Erleichterung zu gelangen, beantragte der während des Krieges amtierende Oberpräsident Friedrich von Moltke (*1852; †1927) am 1. Januar 1917 die Verlegung seines Dienstsitzes nach Kiel und begründete diese als staatsnotwendig. Und tatsächlich erteilte das Innenministerium nun seine Zustimmung, lapidar in einem Telegramm, was nach dem langen Hin und Her davor schon überraschen mag. Die Entscheidung erklärt sich jedoch aus den Kriegsumständen; auch das Kriegsministerium stellte klar, dass es sich nur um eine Kriegsmaßnahme handeln könne.
Am 24. März 1917 legte der Kaiser in seinem Hauptquartier im belgischen Spa mit seinem Placet nach: »Sitz des Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein ohne das Regierungsschulkollegium einstweilen von Schleswig nach Kiel verlegt.« Damit konnte sich Kiel wieder als Provinzhauptstadt begreifen. Um allerdings den provisorischen Charakter der Verlegung zu unterstreichen, erfolgte keine Einrichtung einer offiziellen Dienstwohnung für den Oberpräsidenten. Stattdessen wurde in der Schwanenallee 24 die Villa des Professors für Innere Medizin namens Heinrich Irenaeus Quincke (*1842; †1922) zu diesem Zweck angemietet. Auch wurden zwölf Beamte des Oberpräsidiums nur kommissarisch nach Kiel versetzt. Ihr offizieller Dienstsitz blieb Schleswig. Aber wie es sich so oft mit Provisorien in der Geschichte verhielt, entwickelte sich auch diese Zwischen- zur Dauerlösung: Der Oberpräsident residierte noch weit bis über Kriegsende hinaus in der Schwanenalle 24 und wechselte schließlich am 31. Januar 1923 in den Rantzaubau des Kieler Schlosses. Rund zehn Jahre später meinte Hinrich Lohse (*1896; †1964), NS-Gauleiter und zugleich schleswig-holsteinischer Oberpräsident, am 11. April 1933 zu dieser Frage: »Wenn auch der jetzige Zustand nicht als endgültig angesehen werden kann, so kommt doch eine Änderung durch Verlegung des Oberpräsidiums nach Schleswig in absehbarer Zeit nicht in Betracht.«
Dies war die Verwaltungssituation, auf die die britische Besatzungsmacht am Ende des Zweiten Weltkriegs in Schleswig-Holstein traf. Die alliierten Mächte waren bei der Gestaltung von Verwaltung und Gesellschaft nach dem Krieg um Kontinuität bemüht, und so knüpfte sie auch in der Hauptstadtfrage an die Vorgängerlösung an. Am 16. August 1946 teilte Colonel Ainger in einer Routinebesprechung mit dem deutschen Verbindungsmann bei der Militärregierung, Dr. Hans Müthling (*1901; †1976), den Beschluss mit, dass Kiel der Vorrang vor Schleswig gebühre. »The capital is Kiel«, hieß es wörtlich. Publik gemacht wurde dieser Beschluss mit der britischen Verordnung Nr. 46 vom 23. August 1946, worin die Errichtung eines Landes Schleswig-Holstein mit Kiel als Hauptstadt festgelegt wurde. Als Sitz der Regierung und – einmalig in Deutschland – gleichzeitig auch des Parlaments wurde die Marineakademie am Düsternbrooker Weg erkoren, die im Krieg zum Teil zerstört worden war. Diese dient seit dem 6. Mai 1947 als »Landeshaus«. Am 2. Mai 1950 konnte der Landtag dann in den neu hergerichteten Plenarsaal im Landeshaus einziehen, der im Jahr 2004 nochmals grundlegend umgebaut und durch einen gläsernen Anbau zur Förde hin erweitert wurde.
Kiels neue Stellung als Landeshauptstadt mit Landtag, Landesregierung und Landesverwaltung war eine logische Entscheidung, insofern es die Fortführung seiner Funktion als Provinzialhauptstadt bedeutete. Um den Wegfall des Regierungssitzes Schleswig gegenüber zu kompensieren und damit auch ein gewisses Gleichgewicht innerhalb des Bundeslandes zu schaffen, wurde zum 1. Oktober 1948 das Oberlandesgericht, das ja seit 1894 am Kleinen Kiel residiert hatte, nach Schleswig verlegt. Es zog in die bisherigen Räumlichkeiten des Oberpräsidiums ein und ist hierin auch heute noch zu finden. Ebenso zogen 1948 im Rahmen dieser Ausgleichslösung das Landesarchiv und das Landesmuseum nach Schleswig ins Gottorfer Schloss. Das Landesarchiv wechselte 1991 wiederum aus Platzgründen vom Schloss ins nahe Prinzenpalais, wo es seither beheimatet ist. Seit 1946 fungiert Kiel somit ganz offiziell als Hauptstadt des Landes Schleswig-Holstein, was im Sommer 2016 eine entsprechende Würdigung in der Tagespresse erfuhr. Allerdings stellt sich die Frage, ob Kiel diese Funktion auch künftig einnehmen kann und wird: Die in regelmäßigen Abständen immer wieder aufkommende Idee eines »Nordstaates«, also eines größeren norddeutschen Bundeslandes, indem sich beispielsweise Schleswig-Holstein mit Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern zusammenschließen könnte, beschwört nahezu zwangsläufig die Konkurrenz Hamburgs oder anderer Städte als mögliche Hauptstädte herauf.
Neben diesem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Stadt Kiel zur Landeshauptstadt gibt es einige herausstechende historische Ereignisse, die mit Kiel in Verbindung stehen und weit darüber hinaus von Bedeutung waren – für ganz Schleswig-Holstein oder gar deutschlandweit. Auch diese Ereignisse unterstützten jeweils auf ihre Weise das allmähliche Hineinwachsen Kiels in seine Hauptstadtrolle. Zu denken ist hierbei z. B. an die Kieler Tapfere Verbesserung vom 4. April 1460. Einen Monat zuvor, im März 1460, hatte die schleswig-holsteinische Ritterschaft in Ripen den dänischen König Christian I. (*1426; †1481) zum neuen Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein gewählt und sich in diesem Zusammenhang eine stattliche Anzahl an Privilegien vom neuen Landesherrn ausbedungen. In Kiel nun wurden die Bestimmungen des später berühmt gewordenen Ripener Privilegs teils bekräftigt, teils ergänzt oder weiter präzisiert. Unter anderem wurde die Einberufung jährlicher Versammlungen der Ritter Schleswigs und Holsteins zu Urnehöved bzw. Bornhöved zugesichert. Dazu ist es nicht gekommen, weil ab 1462 gemeinsame Landtage der Landstände stattfanden. Doch war die Kieler Zusage vom April 1460 ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur politischen Partizipation von Klerus, Rittern und Stadtbürgertum.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kiel in der Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kiel in der Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kiel in der Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.