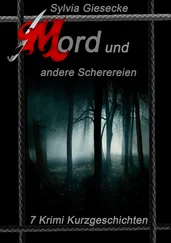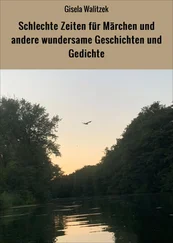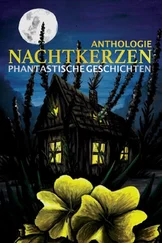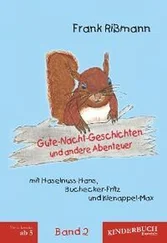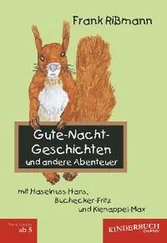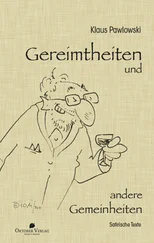Was den Berufsalbaner beziehungsweise die Marktlücke anbelangt: Irgendetwas daran wird wohl stimmen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich der Quotenalbaner oder -migrant bin. Aber mich stört das nicht im Geringsten. Ich empfinde ein größeres Interesse für Migranten als notwendig, auch ein steigendes Interesse für Albanien. Die albanische Bevölkerung innerhalb wie außerhalb der albanischen Grenzen darf nicht mehr zur Geisel profithungriger Politiker oder ultranationalistischer Diktatoren werden. Das geht einfach nicht. Es ist gut, dass das europäische Gewissen in dieser Hinsicht langsam aufzuwachen erscheint.
Sprachwechsler wie Chamisso oder Nabokov, Joseph Conrad oder Elias Canetti sind heute weltberühmte Schriftsteller. Was bringt es für das Verständnis ihrer Werke, wenn man immer wieder auf ihre sprachlichen und kulturellen Wurzeln hinweist?
Ich denke, dass es nicht viel bringt. Nicht, weil sie für mich unbedeutend wären. Das Gegenteil ist der Fall: Sie sind für mich von enormer Wichtigkeit. Ich bin in Albanien geboren und dort sozialisiert worden. Ich habe dort gelernt, was Freundschaft bedeutet, was Vertrauen bedeutet. Ich habe die wichtigsten Werte von dort mitgenommen. Anfangs habe ich gedacht, dass ich mich anpassen sollte, und habe all diese Wertvorstellungen neu auszurichten versucht. Jetzt, da ich in Österreich auch eine Familie gegründet habe und in einer Gegend lebe, in der ich mich sehr wohl, ja angekommen fühle, habe ich erkannt, dass diese Neuausrichtung die Menschen, denen ich begegnet bin, irritiert hat. Ich habe zu dem Menschen zurückgefunden, der ich in Albanien schon war, und ihn hier in Wien wieder zum Leben erweckt. Jetzt sehe ich, dass ich in Wien die gleiche Art von Freundschaften und die gleiche Art von Vertrauen finde, wie ich das als Jugendlicher in Albanien kannte. Dafür musste ich mich, wie gesagt, nicht nur öffnen, sondern von der Vorstellung befreien, dass ich mich da ändern, verändern, anpassen müsste. Ich glaube, dass Authentizität, im Sinne von Offenheit, vor allem auch von Ehrlichkeit, eine sehr bedeutende Stütze jedes menschlichen Zusammenlebens ist. Und damit meine ich, dass jeder zu seinem eigenen Wohl verpflichtet ist, seine Ängste, seine Bedenken oder seine Kritik ehrlich anzusprechen. Aber natürlich auch die Gemeinsamkeiten, die meiner Meinung nach immer überwiegen, wenn man eben ehrlich zu sich selber ist.
Das ist ein zentraler Punkt der westlichen Demokratie, finde ich. Nämlich, dass man auf die Kritik und die Bedenken seines Gegenüber eingeht. Ich finde, dass hier gewisse Rückschritte gemacht werden: Menschen, die Bedenken zu Themen wie Migration und Flüchtlinge äußern, werden gleich in eine Ecke geschoben. Diese Menschen haben aber nicht zuletzt durch die Präsidentschaftswahlen in Österreich und Frankreich ganz deutlich gezeigt, dass sie sich keineswegs so leicht blenden lassen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Dialogkultur etwas schwächer geworden. Aber diese Dialogkultur macht die Demokratie eigentlich aus! Die Österreicher sagen: »Durchs Reden kommen die Leit zamm!«
Aber nun wieder zurück zur Frage, die ich nicht korrekt beantworten kann, wenn ich das oben Gesagte verschwiegen hätte. Also, je länger ich mich in Österreich aufhalte, umso mehr merke ich, dass meine kulturellen Wurzeln nicht einmal so exotisch sind. Aber ich sehe ich mich auch nicht als ein starres System. Wie alle anderen Personen, denen ich begegne, verändere ich mich ständig. Ich verändere mich aber in besonderem Ausmaß. Das hat auch mit meiner Tätigkeit als Autor zu tun. Bei jedem neuen Roman verändere mich beinahe vollständig. Mir scheint, ich bin dann ein ganz neuer Mensch. Ob da die Wurzeln gleich bleiben, vermag ich nicht zu sagen. Sicher wäre es einfacher, wenn es so wäre, aber ich kann nicht sagen, ob das so ist. Man wird sagen: Mit Wurzeln meint man doch die Vergangenheit, und wie soll sich die Vergangenheit verändern? Tatsache ist jedoch, dass sich meine Vergangenheit ständig verändert – je nachdem, aus welcher Perspektive ich darauf blicke, je nachdem, mit welchem Hintergrund und Wissen ich gewisse Details davon interpretiere.
Wenn ich zehn Romane geschrieben habe, wird es vielleicht möglich sein, eine gewisse Regelmäßigkeit, die man dann Wurzeln nennen könnte, auszumachen. Aber an diesem Punkt sind meine zwei Bücher – bei allen Parallelen, die ich bewusst eingebaut habe – unterschiedlich, Formen, die sich ergeben haben, weil mein Leben in Wien so verlaufen ist wie es verlaufen ist. Mein Leben in Wien ist viel bedeutender für meine Texte als meine albanischen Wurzeln. Interessant ist aber, dass sich für dieses Leben in Wien kaum jemand interessiert.
Zusammenfassend bin ich heute der Überzeugung, dass das Feuilleton sich vor allem auf den Text fokussieren sollte. Das ist bei heimischen Autoren auch der Fall. Die Fragen zu sprachlichen und kulturellen Wurzeln sind, glaube ich, Sache der Wissenschaft. Ich habe in der Studie von Holger Englerth gesehen, dass die Wissenschaft dann auch besser davor gefeit ist, in Klischees zu tappen.
Ist für Autoren, deren Muttersprache Ungarisch oder Japanisch oder Französisch ist und die später, warum auch immer, auf Deutsch schreiben, die Muttersprache ein Gewinn, ein Vorteil? Worin besteht dieses Plus? Oder ist die andere Muttersprache manchmal auch ein Hindernis?
Wir sind alle auf Gewinn und Vorteil aus. Das ist wahrscheinlich die Natur, die trotz der ganzen menschlichen Entwicklung wahrscheinlich immer nur das Plus, das Wachstum anstreben wird. Mehrsprachigkeit wird somit auch als ein Plus gewertet. Darüber habe ich lustige Diskussionen bei Kindergeburtstagen geführt. Viele Eltern veranstalten eine Art Wettbewerb: Wer spricht mit seinem eigenen Kind mehr Fremdsprachen? Ich denke dabei an einen Spruch von Lenin, der in meiner Krippe hing, in der ich auch als Erwachsener zufällig einmal war: »Eine Fremdsprache ist eine Waffe im Kampf des Lebens.« Ich habe den Spruch gemocht. Er war vielleicht die einzige an den Wänden prangende Losung von Lenin, die für mich lange Gültigkeit hatte. Die Aussage hat mich fasziniert. Doch irgendetwas hat mich auch irritiert. Jetzt kann ich sagen, dass es die Wörter »Kampf« und »Waffe« waren. Ich sehe Sprache nicht als Waffe und das Leben nicht als Kampf. Es gibt natürlich Zeitspannen, in welchen man das tut. Die gibt es in jedem Leben. Aber man ist dann auch nur ein Krieger. Und was macht so ein Krieger?
Zugleich muss ich aber betonen, dass ich oft unter dem Gefühl leide, eine Sprache zu verlieren. Ich verliere Albanisch, Englisch und auch Italienisch. Italienisch wohl am meisten. Das ist ein großes Minus. Auf Albanisch und Englisch lese und höre ich wenigstens regelmäßig Nachrichten. Es ist wirklich schade, dass man nicht gleichzeitig in drei, vier Ländern leben kann. Ob ich diese Sprachen aber als Bereicherung für meine Texte betrachte? Ehrlich gesagt nicht. Ich verwende sie sehr sporadisch und ohne große Ansprüche. Ich mache kaum Spielchen daraus. Das Einzige, was ich bislang getan habe, ist, einzelne Ausdrücke aus diesen Sprachen in die Texte einfließen zu lassen. Das vor allem mit der Absicht, im Leser ein wenig Neugierde zu wecken und auch das Gefühl zu erzeugen, wie es sein kann, wenn man keine Ahnung hat, was so ein Wort in einem Text, den man vollständig versteht, eigentlich bedeutet. Aber das ist eher als Streich gedacht, nicht als anspruchsvolles Spiel mit der Sprache, das natürlich einige Autoren auf eine bewundernswerte Weise betreiben. Ich denke dabei an Yoko Tawada. Das ist höchste Sprachkunst, die an Magie grenzt. Doch das kann nicht jeder. Auf jeden Fall kann das auf diesem Niveau kaum jemand außer ihr. Deshalb verzichte auch weitgehend auf solche Mittel.
Es gibt die oft strapazierte Metapher vom »Brückenbauen« – Brücken zwischen den Kulturen, Brücken zwischen den Sprachen … Sie haben mal gesagt: »Gott schuf keine Brücken.« Wie meinen Sie das?
Читать дальше