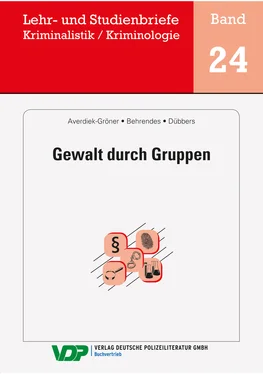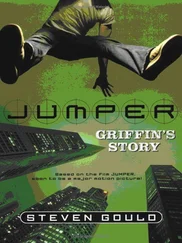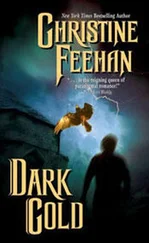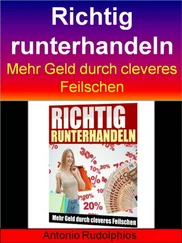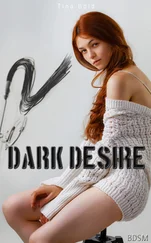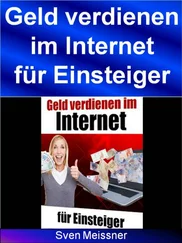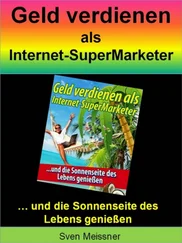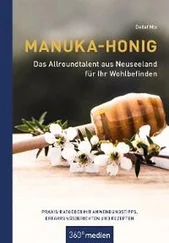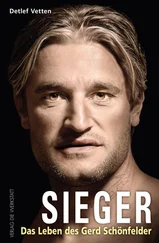1.2.2.3Befragungen im Rahmen der AG Silvester
1.2.2.3.1 Expertenbefragung
1.2.2.3.2 Befragung der Besucher
1.2.2.4Fazit aus der AG Silvester
1.2.2.5Symposium „Silvester 2017“
1.2.3Schlussfolgerungen für die Einsatzvorbereitung Silvester 2017
1.3Die Kölner Silvesternacht 2017/2018
1.4Fazit
Literaturverzeichnis
Detlef Averdiek-Gröner
2Fußball und Gewalt
2.1Das Phänomen in der Entwicklung
2.1.1Gewalt und Sicherheit in den Stadien
2.1.2Nationales Konzept Sport und Sicherheit 1993
2.1.3Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze der Polizei
2.1.4Akteure und Formen der Gewalt im Wandel
2.1.5Nationales Konzept Sport und Sicherheit 2012
2.1.6Fanarbeit der Vereine und Ligen
2.1.7Feindbild Liga und Feindbild Polizei
2.2Polizeiliches Lagebild
2.2.1Allgemeines
2.2.2Störerlage
2.2.3Sicherheitslage
2.2.3.1Verletzte Personen
2.2.3.2Strafverfahren
2.2.3.3Freiheitsentziehende/-beschränkende Maßnahmen und polizeilich sichergestellte/beschlagnahmte Gegenstände
2.2.3.4Tatorte
2.2.3.5Störungen auf Reisewegen
2.2.3.6Drittortauseinandersetzungen
2.2.4Personelle Belastung der Polizeibehörden
2.3Polizeiliches Handeln
2.3.1Leitlinien und Ziele
2.3.2Gefahrenabwehrende Maßnahmen im Vorfeld
2.3.2.1Datei „Gewalttäter Sport“
2.3.2.2Arbeitsdatei „Szenekundige Beamte“
2.3.2.3Intensivtäter Gewalt und Sport
2.3.2.4Gefährderansprachen und -anschreiben
2.3.2.5Meldeauflagen
2.3.2.6Aufenthaltsverbote
2.3.2.7Verwaltungsrechtlicher Entzug der Fahrerlaubnis
2.3.3Einsatzmaßnahmen
2.3.3.1Allgemeines
2.3.3.2Begleitung und einschließende Begleitung
2.3.3.3Fan- und Bannermärsche
2.3.3.4Vermummung und Pyrotechnik
2.3.3.5Bildaufnahmen und Videografie
2.4Handeln der Netzwerkpartner
2.4.1Dialog und Kommunikation
2.4.2Stadionverbote
2.4.3Beförderungsverbote
2.4.4Alkoholverbot
2.4.5Kartenkontingentierung
2.5Unterschiedliche Standards in Europa
Literaturverzeichnis
Anlage 1 Gewalttäter Sport
Anlage 2 Lagebild Fußball
Gewaltbereite Störer der Kategorie B
Gewaltsuchende Störer der Kategorie C
Verletzte Polizeibeamte 1.– 3. Liga
Pyrotechnik
Öffentlicher Personenverkehr
Udo Behrendes
3Gewalt bei Demonstrationen
3.1Erkenntnisquellen zu Art und Ausmaß der Gewalt bei Demonstrationen
3.1.1Polizeiliche Kriminalstatistik und Verfassungsschutzberichte
3.1.2Polizeiliches Erfahrungswissen
3.1.3Wissenschaftliche Studien
3.2Entstehung von Gewalt bei Demonstrationen
3.2.1Geplante Gewaltaktionen
3.2.2Situative Gewaltaktionen
3.2.2.1Gewaltfalle „Verbotene Symbole“
3.2.2.2Gewaltfalle „Sitzblockade“
3.2.2.3Gewaltfalle „Vermummung“
3.3Zielrichtungen der Gewalt bei Demonstrationen
3.3.1Gewalt gegen Protestadressaten
3.3.2Gewalt gegen Meinungsgegner
3.3.2.1Gewalt im Rahmen von Gegendemonstrationen
3.3.2.2Gewalt gegen Meinungsgegner innerhalb einer Demonstration
3.3.2.3Gewalt gegen Meinungsgegner durch Angriffe von außen
3.3.3Gewaltaktionen außerhalb einer konkreten Demonstration
3.3.4Ausweitung von Gewaltaktionen zu „Riots“
3.4Sozialwissenschaftliche Befunde zu Eskalations- und Deeskalationsbedingungen bei Demonstrationen
3.4.1Binnenstrukturen von (Groß-)Demonstrationen
3.4.2Wechselseitige Selbst- und Fremdbilder von Demonstranten und Polizisten
3.4.3Situative Einflussfaktoren auf die Stimmungslage von Demonstranten und Polizisten
3.4.4Gewaltfördernde Einflussfaktoren
3.4.5Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
3.5Das Deeskalationsprinzip
3.5.1Die Vorgaben des BVerfG
3.5.2Die Umsetzung des Kooperationsgebots
3.5.2.1Fallbeispiel: „Sternmarsch auf Bonn“
3.5.2.2Kooperation zwischen Versammlungsbehörde bzw. Polizeiführung und Veranstalterebene im Vorfeld einer Demonstration
3.5.2.3Kooperation zwischen Polizei und Veranstalterebene vor Ort
3.5.3Die Umsetzung des Differenzierungsgebots
3.5.3.1Die Heterogenität von (Groß-)Demonstrationen
3.5.3.2Differenzierungsgebot vs. „polizeiliche Standards“
3.5.3.3Isolierung gewaltaffiner Gruppen
3.5.3.4Fallbeispiel: Integration gewaltaffiner Gruppen
3.5.3.5Differenzierung zwischen unterschiedlichen gewaltaffinen Gruppierungen
3.5.4Die Ambivalenz des Deeskalationsbegriffs
3.5.4.1Die Ausgestaltung des Deeskalationsprinzips in der PDV 100
3.5.4.2Deeskalation durch Stärke
3.5.5Vertrauensbildende Maßnahmen
3.6Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Zu den Autoren
Carsten Dübbers
1Die Dynamik von Gewalt durch Gruppen am Beispiel der Kölner Silvesternächte
Dieser Aufsatz betrachtet das Phänomen der Gruppengewalt im Rahmen der Kölner Silvesternächte 2015, 2016 und 2017 und des polizeilichen Umgangs mit ihm.
Hierbei wird die Silvesternacht 2015/2016 nur kursorisch behandelt, da der Schwerpunkt des Aufsatzes darauf liegt, die Nutzung der Erkenntnisse aus dieser „ersten“ Silvesternacht in der polizeilichen Praxis in den beiden Folgejahren zu beschreiben. Die Ereignisse während und nach der ersten Silvesternacht haben diese Republik verändert und sind aus sehr unterschiedlichen Perspektiven diskutiert worden. Im Rahmen dieser Diskussionen ging es aber kaum um die Entstehung von Gewalt in Gruppen; vielmehr hatten die großen Migrationsströme insbesondere aus Nordafrika und dem Nahen Osten die öffentliche Meinung erhitzt und die Asyldebatte geprägt.
Insbesondere ist der Blickwinkel dieses Aufsatzes darauf gerichtet, wie gruppendynamische Prozesse, wie sie Silvester 2015/2016 am und im Kölner Hauptbahnhof stattfanden, verhindert werden können. Relevant ist diese Fragestellung deshalb, weil die Entstehung und Entfaltung dieser Prozesse nicht zuletzt dem Umstand geschuldet war, dass die Polizei keine Eingriffsmöglichkeiten hatte und die Anzahl der eingesetzten Kräfte und die Anzahl der Störer in einem vorher nicht zu erahnenden Missverhältnis standen. Die polizeiliche Prävention solcher gruppendynamischer Prozesse in der Zukunft ist daher von erheblichem Interesse und eine detailliertere Schilderung davon, wie das Polizeipräsidium Köln in den Folgejahren erfolgreich eine solche Entwicklung mit unterschiedlichen Konzepten verhindern konnte, bietet sich als Fallstudie an.
1.1Die Kölner Silvesternacht 2015/2016
Wenige Ereignisse haben in den letzten Jahren einen so starken kriminalpolitischen Einfluss gehabt wie die Kölner Silvesternacht 2015/2016. Die in dieser Form in Deutschland erstmalig aufgetretenen massenhaften und gemeinschaftlich begangenen Eigentumsdelikte durch zahlreiche Männergruppen sind insbesondere deshalb in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung geraten, weil sie zum Teil tateinheitlich mit sexuellen Übergriffen begangen wurden. Auch wenn die weithin publizierten zahlreichen Vergewaltigungen nicht der realen Kriminalitätslage entsprechen, haben eine offenkundige Schutzlosigkeit und die für die betroffenen Frauen extrem belastenden sexuellen Übergriffe den Blick auf die Themenfelder des sexualstrafrechtlichen Schutzes von Frauen und des Umgangs mit Flüchtlingen aus dem nahöstlichen und nordafrikanischen Raum, insbesondere den sogenannten „Maghreb-Staaten“, gelenkt.
Der Kölner Polizei wurde vorgeworfen, dass sie in der Nacht, aber auch schon bei der Lageeinschätzung und Einsatzplanung im Vorfeld, versagt habe. Gestützt wurde die Einschätzung des Versagens durch die mindestens als ungeschickt zu bezeichnende Pressearbeit der Kölner Polizei in diesem Zusammenhang.
Читать дальше