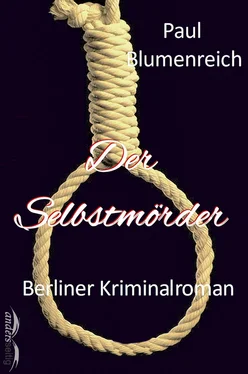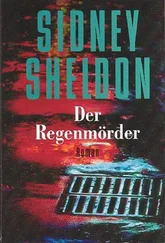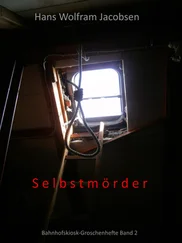Paul Blumenreich - Der Selbstmörder
Здесь есть возможность читать онлайн «Paul Blumenreich - Der Selbstmörder» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Selbstmörder
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Selbstmörder: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Selbstmörder»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Selbstmörder — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Selbstmörder», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aber Paulinens Spott reizte ihn, und eines Tages, an der Ecke, wo sie sich immer trennten, rief er:
»Wahrhaftig, Fräulein Pauline, wenn Sie wollten, ich biete Ihnen meine Hand.«
»Auch wenn ich nichts erbe, Herr Waldenburg?« bemerkte sie.
»Sie sehen, wie offenherzig ich bin,« antwortete er; »auch wenn Sie nichts erben, denn ich weiß, Sie sind ein vortreffliches Mädchen.« Pauline schwieg einen Augenblick.
»Ich bin der Liebe eines Mannes nicht ganz unwert,« sagte sie ernster, »das weiß ich wohl. Aber ich bin arm, blutarm, und dazu bin ich fest überzeugt, daß meine Tante nichts, so gut wie nichts hinterläßt.«
Der kleine Waldenburg legte die Hand aufs Herz, beteuerte die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung. Er sah ordentlich hübsch aus, nur daß Pauline auf ihn herabblicken mußte. Nun platzte er heraus:
»Ach, Fräulein Pauline, sehen Sie, mein ganzes Unglück ist, daß ich so klein bin. Niemand nimmt mich ernst, kein Mädchen will mich lieben.«
»Es ist wahr,« bestätigte Pauline; »auch ich habe Sie bisher nicht ernst genommen, aber nicht weil Sie so klein sind, sondern weil Sie auch mit Josepha liebäugelten.«
»O,« versicherte er eifrig, »das ist nur die Artigkeit, die man der Tochter des Hauses schuldet.«
»Gut denn,« sagte sie, ihm die Hand reichend; »wenn ich Ihnen unrecht getan habe, wird sich's ja zeigen. Wir wollen es uns beide bedenken.«
»Sie ist ganz reizend,« sagte sich der Kommis, als sie verschwunden war. »Aber bedenken muß man's doch. Josepha ist im Grunde frei, und das wäre eine Partie. Und ich bin ja doch von altem, guten Adel.«
Auch Pauline dachte bei sich:
»Ich muß ihn noch erproben, ich traue ihm nicht.«
Zu Hause öffnete ihr niemand auf ihr Klingeln; endlich kam der kleine Walter, die Tante sei wieder sehr schwer krank.
Und wirklich, soeben war die Greisin von einem neuen Schlaganfall betroffen worden. Der Arzt hatte ihr gestern gestattet, Kaffee zu trinken, und sie hatte sich so sehr gefreut darüber. Da fiel sie auf einmal vom Stuhl. Pauline kam eben recht, ihr die Augen zuzudrücken.
Das gab einen ungeheuren Aufruhr in der kleinen Häuslichkeit. Die winzige Barschaft, welche die Tante hinterließ, würde kaum für die Beerdigung hinreichen. Man hatte sich in letzter Zeit mancherlei Mehrkosten auferlegen müssen, immer im stillen auf die Erbschaft hoffend. Das Testament war gerichtlich deponiert, im Hause fand sich nur etwas Schmuck und ein kleines Sparkassenbuch. Dennoch raffte die Familie alles zusammen; man wollte sie doch anständig zur Ruhe bringen.
Am Tage darauf fand die Testamentseröffnung statt. Es war eine höchst umständliche Verfügung, man hätte glauben sollen, es handle sich wirklich um eine nennenswerte Hinterlassenschaft. Aber schließlich war es nichts, so gut wie nichts, die Tante hatte ihre Angehörigen nicht enterbt, aber sie hatte auch nichts zu vererben als Schmuck, Wäsche, Kleider, Möbel und jenes Sparkassenbuch.
Natürlich kam das alles der Familie sehr zu statten, das Büchlein deckte auch reichlich die Kosten, aber von einer Erbschaft konnte eben nicht die Rede sein. Die großen Hoffnungen der Familie waren vernichtet, die Tante hatte nichts erspart, oder das Ersparte auf irgend eine törichte Weise verloren, deren sie sich geschämt. Genug, es war nichts.
Man wollte nun die Stube an einen Herrn vermieten, es wurde alles geräumt. Nach der Testamentsverfügung fiel ein Teil des baren Geldes der Mutter zu, der Schmuck Paulinen, den Jungen allerlei Kleinigkeiten; Möbel und Wäsche sollten alle zusammen haben, so hatte die Tante höchst gewissenhaft disponiert.
Am folgenden Sonntage begann man zu räumen. Die Mutter war bald getröstet; es zeigte sich, die Betten waren schön leicht, lauter Daunen, vortreffliche Bezüge, die Möbel zwar altmodisch, aber dauerhaft, und aus den altfränkischen Kleidern würde noch mancherlei zurecht gemacht werden können. Die Jungen machten sich über den alten Kram her, Bücher, Kuriosa, Erinnerungsstücke. Walter bekam sozusagen den Abhub, Muschelchen, Riechfläschchen und was dergleichen zu Tage kam; aber er freute sich nach Kinderart.
Von der Wäsche sollte etwas verwahrt werden für Paulinens Aussteuer, meinte die Mutter. Pauline lächelte schmerzlich, aber die Mutter sagte, das Kaufen würde immer schwer gehen.
»Und da, sieh, ein wattierter Rock, noch fast neu!« – Es war der rote Rock, von dem die Tante gesprochen; und nun pochte Pauline das Herz. »Den kannst Du Dir behalten,« sagte die Mutter; »mich würde er zu dick machen, Dir wird er im Winter an der zugigen Kasse sehr gut zu statten kommen.«
»Gut, Mamachen,« sagte das Mädchen. Mit einemmale erinnerte sich Pauline an jene Nacht, an die geheimnisvollen Worte der Tante, an ihren leuchtenden Blick. Wenn die die Frau wirklich eingesehen hatte, daß Pauline eine Belohnung um sie verdient hatte! – Und versteckten alte Leute nicht oft ihr Geld in dieser Weise? –
Sie legte den Rock in ihren Schrank. Der Mutter wollte sie keine vorzeitigen Hoffnungen machen und sie nahm sich vor, abends, wenn alles schlief, den Rock zu untersuchen.
*
War er tot? –
O, wenn Armin dieser Frage hätte entrinnen können, wenn er wüßte, ob jener tot! – Und doch, war es nicht sündhaft, seinen Tod zu wünschen? – Und wiederum, sein, Armins ganzes Lebensglück beruhte darauf, daß jener nicht mehr unter den Lebenden weilte. Aber in streng christlichen Grundsätzen erzogen, sträubte sich sein Gewissen, den Tod des anderen zu wünschen.
Armins Blick versuchte vergeblich, das finstere Dunkel dieses Geheimnisses zu durchdringen. Einen Augenblick fiel ein Lichtstrahl, als man einen Diebstahl zu bemerken glaubte; aber das war jemand anders gewesen, jenes blonde Mädchen an der Kasse, welches er eigentlich noch nicht gesehen und an deren Schicksal er kein Interesse nahm, denn er sah nur Josepha. Das Mädchen mit dem schönen, blassen Gesicht, den dunklen Augen, dem jungfräulich keuschen und doch hingebenden Wesen hatte seine ganze Seele gefangen genommen.
Jener Augenblick, da sie, wenn auch durch einen Irrtum, an seiner Brust lag, war entscheidend gewesen für seine ganze Existenz. Eine überirdische Seligkeit, ein Fortgerissenwerden, eine glühende Hingebung, wie er sie bisher nicht kannte, ein einziger Wunsch, eine einzige lodernde Flamme erfüllte ihn: Josepha nahe zu sein.
Am Morgen nach jenem Abende, da er Josepha gesehen, hatte er sich zu dem großen Gange gerüstet. Nie sonst in seinem Leben hatte er Aehnliches gewagt: Die Erbschaft eines Mannes anzutreten, der vielleicht nicht tot war, seiner Braut sich zu nähern, ihre Liebe zu begehren. Aber er konnte nicht anders, denn er mußte in Josephas Nähe bleiben, er mußte tun, was sie wünschte: und so suchte er seinen schwarzen Anzug, seine Papiere hervor, und machte sich auf den Weg zu Hilmar.
Es war ihm elend zu Mute, und doch war er voll überseliger Hoffnungen für die Zukunft; er zitterte und bebte – und doch, er stand vor dem Hause, wo sie wohnte, vor dem Hause ihrer Eltern. Welch' beglückende Vorstellung!
Herr Hilmar nahm ihn für nichts als einen Stellensucher. Er fand sein Erscheinen durchaus natürlich; der Unfall war von den Zeitungen gemeldet, auch wohl in den beteiligten Kreisen bekannt geworden: Vielleicht schmeichelte es ihm sogar, daß man sich, noch bevor er jemanden suchte, an ihn wandte.
Auf die korrekt vorgetragene Bewerbung Armins antwortete er:
»Sie kommen eigentlich zu früh. Noch habe ich keine offizielle Nachricht von dem Tode meines Neffen, noch hoffen wir. Vielleicht hat nur ein Zufall ihn verhindert, zurückzukehren.«
»Selbstverständlich würde ich zurücktreten,« beeilte sich Armin zu versichern, »wenn Ihr Herr Neffe wiederkäme. Ich würde es mit Freuden tun, wenn ich sähe, daß ein schweres Unglück von einer ehrenwerten Familie abgewendet wird.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Selbstmörder»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Selbstmörder» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Selbstmörder» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.