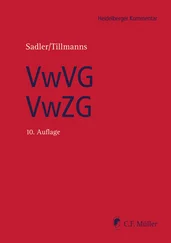Während sie las, wagte Johanna kaum zu atmen und wandte den Blick nicht von Sophies Gesicht.
Als Sophie geendet hatte, legte sie den Brief beiseite und starrte zur Decke. »Wie abscheulich«, flüsterte sie. »Wie gemein.«
Johanna hob die Hand, um Sophies Wange zu streicheln, ließ sie dann aber hilflos wieder sinken.
»Wisst ihr, wer das war?«, fragte Sophie rau.
Johanna schüttelte den Kopf. »Nein. Als wir nach Hause kamen, sahen wir drei Gestalten durch den Garten rennen. Sebastian und Großvater haben noch versucht, sie einzuholen, haben sie aber nicht erwischt.«
»Weiß Raphael davon?«
»Nein.«
»Aber er muss doch mitbekommen haben …«
»Wir haben ihm erzählt, dass die Einbrecher Angst bekommen haben, nachdem sie seinen Schrei gehört hatten. Wir sagten ihm, sie hätten sicher vermutet, dass niemand im Haus sei, und dass sie mit dem Stein nur das Fenster einwerfen wollten.«
»Und das hat er geglaubt? Ich meine, ich habe doch alle Lichter im Haus angemacht, und er weiß, dass dann normalerweise keine Einbrecher kommen. Vor allem nicht in diesen Zeiten, wo alle sparen müssen und niemand das Licht brennen lassen würde, wenn keiner zu Hause ist.«
Johanna zuckte die Schultern. »Warum sollte er es nicht glauben? Wie sollte er ahnen, was wirklich dahintersteckt?«
»Um Raphael mache ich mir die meisten Sorgen«, flüsterte Sophie unglücklich. »Um mich habe ich keine Angst, aber wenn sie meinem Buben etwas tun …« Panik flackerte in ihrem Blick.
»Ich hielte es für das Beste, wenn du von hier fortgingest«, wagte Johanna einen Vorstoß.
Sophie riss die Augen auf. »Von hier fortgehen? Aber wohin denn?«
»Vielleicht nach Konstanz, zu Vater und Mutter.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht, Johanna. Ich kann mich nicht im Haushalt meiner Schwester verstecken.«
»Warum nicht? Es wäre das Sicherste.«
»Ich will mich nicht beugen, ich möchte nicht davonrennen. Das habe ich noch nie getan.«
»Dann wird es Zeit, dass du es lernst. Du darfst nicht glauben, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn du gehst. Es wäre eher trotzig und unverantwortlich, wenn du bliebest. Du hast Raphael gegenüber eine Verantwortung.«
Sophie sah sie nachdenklich an. »Sobald dem Jungen auch nur die kleinste Kleinigkeit passiert, werde ich gehen, das verspreche ich dir. Aber vorher nicht.«
»Wenn ihm bereits etwas passiert ist, ist es zu spät«, erwiderte Johanna heftig.
Sophie wandte den Kopf zur Seite. Ihr kam eine ganz andere Idee: Wenn sie schon gehen musste, warum dann nicht zu ihrem Bruder Siegfried und seiner Frau Luise ins Ruhrgebiet? In die Höhle des Löwen sozusagen? Dort wusste immerhin keiner außer Siegfried und Luise, dass Raphael Halbfranzose war. Und die beiden würden sie nie verraten. Sophie wagte zwar immer noch nicht daran zu glauben, dass Pierre unter den französischen Besatzern sein könnte, sie war sich nach wie vor fast sicher, dass er im Krieg gefallen war, aber es war zumindest der Hauch einer Chance.
Sophie war in der Zwickmühle. Einerseits lastete die Verantwortung für Raphael schwer auf ihr und sie wollte ihn keinesfalls in Gefahr bringen, andererseits war da diese unbändige Wut, die Entschlossenheit, sich nicht kleinkriegen zu lassen – von wem auch immer. Und die schwache Hoffnung, dass Pierre unter den Besatzern sein könnte und sie ihn eines Tages durch Zufall wiedersehen würde.
Sie wusste aber, dass Johanna von ihren Plänen nicht begeistert sein würde. Und momentan fehlte ihr die Kraft für große Diskussionen. Deshalb seufzte sie nur und sagte ausweichend: »Ich muss darüber nachdenken.« Sie schloss die Augen. »Ich muss erst mal mit all dem ins Reine kommen.«
»Gut«, erwiderte Johanna. »Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da, Sophie. Jetzt lasse ich dich allein.«
Sophie nickte dankbar. Als Johanna gegangen war, stand sie zum ersten Mal, seit ihr der Stein an den Kopf geflogen war, auf und ging ans Fenster. Sie ignorierte die Schwäche in ihren Beinen und den erneuten dumpfen Schmerz in ihrem Kopf. Dann zog sie ihr Notizbüchlein hervor und schrieb:
Was soll ich nur tun? Lieber Gott, was soll ich nur tun?
München, Bayern, 23. Januar 1923
»Wenn das nicht die kleine Marlene ist.«
Marlene zuckte zusammen, als sich ihr eine Hand auf die Schulter legte. Bisher hatte sie sich schrecklich unwohl gefühlt. Seit sie in diesem Lokal angekommen waren, in dem alle Bier aus riesigen Krügen tranken, seit Lisbeth ihren Verlobten und ihre anderen Freunde getroffen hatte, fühlte sie sich wie eine Außenseiterin. Und sie war es auch. Lisbeth bemühte sich zwar nach Kräften, sie immer wieder ins Gespräch zu ziehen, aber sie kam einfach aus einer anderen Welt. Sie wusste nichts von ihren Themen, ja, sie verstand nicht einmal ihren Dialekt. Und nun also die Hand auf ihrer Schulter. Die Stimme kam ihr entfernt bekannt vor. Sie wandte sich um und blickte in die Augen ihres Schwagers. Wie lange war es her, dass sie den Bruder des Mannes ihrer Schwester – war das überhaupt ein Schwager? – zum letzten Mal gesehen hatte? Zwei Jahre? Drei? Sie hatte nicht gewusst, dass er so gut aussah. So männlich und so markant. Marlene spürte, wie ihr Herz schneller schlug, merkte auch, dass ihr die Röte ins Gesicht stieg. Zum Glück war Andreas schnell abgelenkt, er wurde von den anderen herzlich begrüßt, schien dazuzugehören zu ihrem Freundeskreis. Wie klein die Welt doch ist, dachte Marlene.
Sie sprachen den ganzen Abend kein Wort mehr miteinander, aber ihre Blicke verfingen sich immer wieder, und Marlene kramte in ihrem Gedächtnis, was sie über diesen Schwager wusste. Johanna und ihr Mann Sebastian konnten ihn nicht leiden, das hatte sie noch ganz deutlich in Erinnerung. Aber warum nicht? So angestrengt sie auch überlegte, sie kam nicht darauf. Aber an eines erinnerte sich Marlene mit einem Mal: dass Andreas eigentlich auch am Bodensee lebte, verheiratet war und zwei Kinder hatte. Diese Erkenntnis traf sie mit ungeheurer Wucht, es fühlte sich an wie ein Schlag in den Magen. An der Faszination, die Andreas auf sie ausübte, änderte das nichts.
Und als er am 28. Januar mit der SA auf dem Marsfeld aufmarschierte, stand Marlene am Wegesrand und warf ihm bewundernde Blicke zu.
Deauville, Frankreich, 26. Januar 1923
Pierre Didier öffnete vorsichtig die Tür zur Küche und sah Michelle am Tisch sitzen. Er hatte Angst, denn er wusste: Was jetzt kam, würde über sein künftiges Leben entscheiden. Obwohl er nach dem letzten Gespräch entschlossen gewesen war, sich von ihr zu trennen, und das Gefühl gehabt hatte, sie nicht einen Tag länger ertragen zu können, hatte er sich doch entschieden, ihr einen Neuanfang anzubieten. Er hatte Hemmungen, einfach so fortzugehen, so sehr er sich auch nach Sophie sehnte und so sehr Michelle ihn anwiderte. Außerdem waren da noch die beiden Kinder …
Zögernd stieß er die Tür ganz auf.
Michelle blickte auf und musterte ihn kalt.
Ich glaube, ich muss erfrieren neben dieser Frau, dachte Pierre, doch er zwang sich zu einem Lächeln.
»Guten Morgen, Michelle«, sagte er höflich und beugte sich zu ihr herunter, um sie auf die Wange zu küssen.
Michelle ließ es geschehen, erwiderte aber weder seinen Gruß noch seinen Kuss. Sie rührte sich nicht.
»Wo sind die Kinder?«
»Mit dem Kindermädchen im Park, wie jeden Morgen«, antwortete Michelle kühl.
»Ach ja, richtig, wie dumm von mir.« Pierre fühlte sich immer unwohler in seiner Haut.
»Michelle, ich muss etwas mit dir besprechen.«
Michelle sah auf. Sie verzog noch immer keine Miene, aber an dem leisen Flackern in ihrem Blick bemerkte er, dass sie doch nicht ganz so gleichgültig war, wie sie sich gab. Dass sie nur eine Maske aufgesetzt hatte und hinter dieser immer noch die verzweifelte Frau war, die so leicht in Tränen ausbrach.
Читать дальше