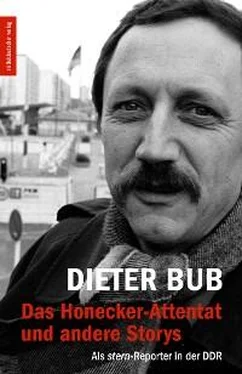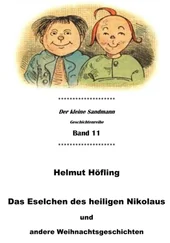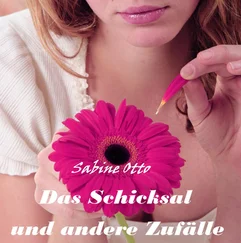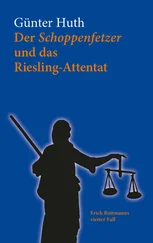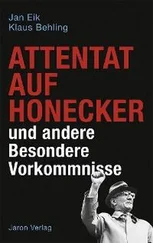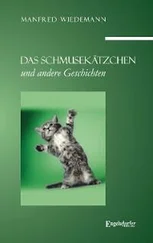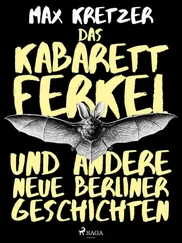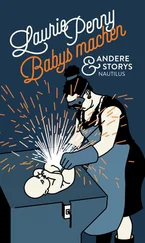Dieter Müller: Der Junge im Familienalbum, aufgenommen mit der Box-Kamera, unbeholfen schüchtern im großen Garten An der frohen Zukunft in Halle mit Oma und Dackel Lumpi. Spielkameraden gab es hier nicht, nicht an den Wochenenden mit Hefekuchen und Kaffee aus der Thermoskanne. Lumpi, Freund mit fliehenden Schlappohren im Rucksack auf dem Fahrrad. Später: Der Junge bei der Klassenreise in Wernigerode, zusammen mit anderen. Dazu Fotografien, die er selbst aufgenommen hat – Landschaften, Waldstimmungen. Regentage, Regennächte. Das Zelt durchlässig. Im Dunkel der Kopf in einer Wasserlache. Ärger mit dem Pfarrerssohn, Dombrowski, arrogant, eifersüchtig auf Müller, der, im Gegensatz zu Dombrowski, dem einsamen Orgelspieler, mit seinen Darbietungen am Flügel in der Schule Erfolg hat und selbst bei den Lehrern beliebt ist, deren Fächer er vernachlässigt.
Später: Der Junge nach dem Besuch der Steherrennen im Kurt-Wabbel-Stadion auf dem Fahrrad bei einem Radrennen, von der Schule veranstaltet. Müller hat als zweiter das Ziel erreicht, vor Klaus Kohl, dem Jungen mit dem Mecki-Haarschnitt, auf dem dritten Platz, ein Triumph des schlechten Geräteturners.
Alles gegenwärtig. Ich sehe den Kreiselplatz vor dem Haus, die Gärten, das Kind unterwegs mit dem Leiterwagen, hoch beladen mit Obst und Gemüse, die große Ernte im Herbst. Kilometer von der Frohen Zukunft und vom Krokusweg (zwei Gärten im Sozialismus!) in die Schleiermacherstraße. Ächzende Räder unter der Last. Der Junge an der Deichsel, die Früchte des Sommers zum Überwintern: Birnen und Kohl, Bohnen, Kartoffeln, Gurken, Tomaten. Der Geruch des Herbstes, von den Obststiegen im Keller, Regale voller Gläser, Marmelade und Gemüse, in einem großen grauen Topf auf dem Kohleherd eingeweckt, verschlossen mit Gummiringen.

Dieter Müller als Kind im Garten in Halle-Mötzlich
Müller will nach Grünheide, zu Robert Havemann, ohne Genehmigung. Schmitt hält das für falsch. Keiner der Journalisten fährt zu Havemann. Der Regimekritiker stand bis vor kurzem unter Hausarrest, durfte sein Grundstück nicht verlassen, Kontakte zu Personen aus dem Westen waren ausdrücklich untersagt. „Wir sollten nicht fahren“, meint Schmitt. „Wir werden Schwierigkeiten bekommen.“
„Kann sein“, entgegnet Müller, „aber sie können uns nichts anhaben. Sie können uns nur ausweisen.“
„Das willst du riskieren?“, fragt der Jüngere den Älteren. „Nach so kurzer Zeit?“
„Sie werden uns verwarnen“, sagt er. „Mehr wird nicht passieren.“
„Wir müssten uns im Ministerium abmelden“, meint der Fotograf. „Das ist Vorschrift.“
„Warum sollen wir uns abmelden, wenn wir ohnehin keine Genehmigung erhalten? Was auch immer wir unternehmen, es ist illegal.“
Als sie die Stadtgrenze bei Köpenick passieren, wird ihre Nummer von der Volkspolizei notiert. Hinter Erkner biegen sie, gegenüber der Autobahnauffahrt, nach links Richtung Grünheide, sie erreichen verbotenes Terrain. An einem Waldstück parkt der zweite Streifenwagen, der dritte ist hinter der Einfahrt zur schmalen Burgwallstraße postiert. Meldungen an die Zentrale, Information an die Staatssicherheit vor Ort.
Hier draußen, am Rande der Stadt, in Hessenwinkel, Grünheide, Müggelheim, Wendenschloss sind Staatsschauspieler, Wissenschaftler, Maler, Schriftsteller, Komponisten und Unterhaltungsmusiker zu Hause, die das Wohlwollen der Partei genießen, die zum Kulturminister, anderen Regierungsmitgliedern und zur SED-Führung gute Kontakte haben, für Wohlverhalten ausgezeichnet mit Verdienstorden, materiellen Privilegien und mit Reisegenehmigungen ins kapitalistische Ausland. Sie haben sich eingerichtet, wissen gut zu leben, so wie vor ihnen andere.
Die Gebiete wurden mit der Industrialisierung und dem Aufschwung Berlins zur deutschen Hauptstadt besiedelt. Industrielle und Kaufleute zogen aufs Land, bauten ihre Landhäuser und Sommer-Domizile, prachtvolle Villen, Schwarzwaldhäuser, kleine Schlösser und Burgen. Sommerfrische für die Industriegewinnler, die Arbeiter in den Tbc-Hinterhöfen von Wedding, Neukölln, Prenzlauer Berg. Die Künstler kamen. Den Autor des sozialen Elends, Gerhard Hauptmann, zog es nach Erkner, Fontane nach Neuglobsow, den Maler Findus nach Woltersdorf, den Stummfilmstar Henny Porten nach Hessenwinkel.
In der sozialistischen Gegenwart hat der einstige Häftling Erich Honecker im Gefängnis von Brandenburg den Kommunisten und einstigen Mithäftling Robert Havemann hier draußen festgesetzt, weil Annäherung und Verständigung unmöglich sind, aber Festnahme, Verurteilung und Zuchthaus zu internationalen Protesten führen und dem Image des Staates großen Schaden zufügen würden.
Dabei hat Havemann seine Isolation selbst verschuldet. Einst privilegierter anerkannter Wissenschaftler, SED-Mitglied und Stalinist, der Mitglieder der jungen Gemeinde bekämpfte, Besitzer eines traumhaften Seegrundstückes, hatte er sich nicht an die Regularien erforderlicher Machtpolitik gehalten und war anderen Sinnes geworden – ein Kritiker des Regimes, der ohne Rücksprache und Rücksicht Veränderungen forderte. Das Ärgerliche: Havemann ist noch immer, trotz allem, trotz Stalin, trotz Ulbricht, trotz der Entziehung seines Lehrauftrags, trotz Verleumdungen, trotz seiner Ächtung ein Verfechter kommunistischer Ideale geblieben, ein Radikaler.
Auf der Burgwallstraße stehen auffällig zwei Männer. Die beiden Fremden parken den Wagen vor dem Grundstück. Unter Beobachtung klingelt Müller an der Gartentür. Eine Frau Mitte zwanzig, schulterlanges dunkles Haar, öffnet: Katja Havemann. Sie ist nicht überrascht, nach Grünheide sind viele zu Besuch gekommen, aus dem Osten und aus dem Westen: Schriftsteller, Liedermacher, Wissenschaftler, und früher, vor dem Hausarrest, auch Journalisten. Nur die meisten Politiker aus der alten Bundesrepublik wagen nicht, sich mit dem Dissidenten zu treffen. Sie fürchten Verstimmungen im deutsch-deutschen Dialog, sprechen nicht über die Opposition in der DDR. Feigheit. Und: Havemann ist ihnen mit seinem klaren Bekenntnis zu einer kommunistischen Gesellschaft suspekt. Zu den wenigen Besuchern gehören Petra Kelly und Gert Bastian von den Grünen.
Havemann begrüßt Müller und Schmitt im Wohnraum, groß, mit schütterem Haar, gebeugt, begegnet den Besuchern freundlich, hat sie nicht erwartet. Es ist einsam geworden um ihn, hier draußen, mit dem Hausarrest, Mit der Belagerung der kleinen Straße, mit den Schikanen hat der Staatssicherheitsdienst Abschreckung bewirkt. Furcht, Angst vor Repressalien, Bedenken.
Sie sitzen im Wohnzimmer. Katja bietet Tee an. Robert Havemann stellt das Radio laut. Sie stecken die Köpfe zusammen, unterhalten sich, Gespräche nah in das Ohr des anderen. Richtmikrofone ohne Wirkung. Sie gehen in den Garten, auf dem weiträumigen Grundstück, das nach unten zum See führt.
„Wo sitzen die Freunde?“, fragt Müller.
„Gleich nebenan, im Flachbau, haben sie sich eingerichtet und ihre Mikrofone und Fotoapparate installiert. Auf der Straße die beiden habt ihr gesehen, und schräg gegenüber“, antwortet Havemann.
„Hin und wieder stehen auch mal zwei auf den Bootsstegen der Nachbarhäuser. Wir grüßen sie, keine Reaktion. Im vergangenen Jahr hatten wir vorübergehend Flutlicht. Drüben auf dem Dach war ein Scheinwerfer installiert. Dazu das stärkste Lichtaggregat von Seeseite. Nach ein paar Wochen war der Spuk vorüber.“ Hausarrest in der Idylle. Eingesperrt im eigenen Land, im eigenen Haus, eingemauert und umzingelt.
Читать дальше