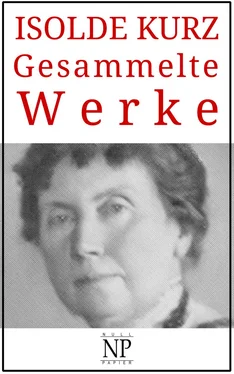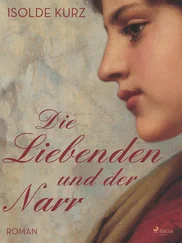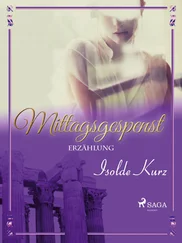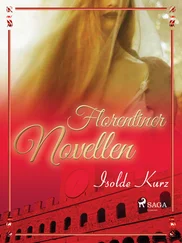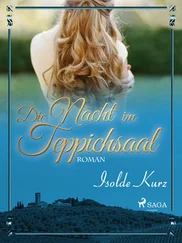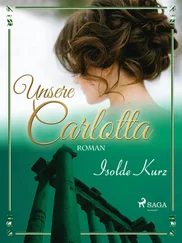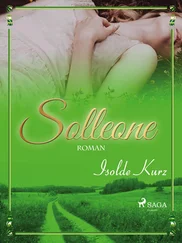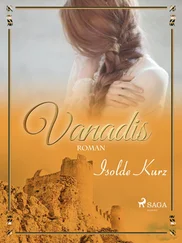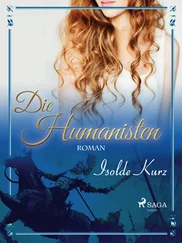*
Es war im Sommer 1899. Die Hitze war unsäglich, das wasserlose, immer von Staubwirbeln durchtobte Florenz, aus dem alle Freunde sich geflüchtet hatten, für Mama und mich unbewohnbar geworden. Ich nahm also das Mütterlein noch einmal mit all ihren Reiseängsten unter die Fittiche und entführte sie glücklich, was nicht so leicht war, wie es scheinen mag, in das reizende Villabruna bei Feltre, wo Alfred mit den Seinen sich zur Sommerfrische in einer behaglichen Villa aufhielt und wir beide nebenan das bescheidene, aber angenehm luftige und blumenduftende Schulmeisterhaus bezogen. Alfred war selig, endlich wieder einmal seine Mutter bei sich zu haben, er umgab sie mit den zärtlichsten Aufmerksamkeiten wie eine Geliebte. Ich schrieb dort die Heimatnovelle »Werters Grab« für den Zyklus »Von Dazumal«, indem ich meine äußere Schau für die nahe Bergwelt abriegelte und mir innerlich die Bühne meiner Kindheit heraufbeschwor, was mir das kleine verwahrloste Gärtchen, wo ich schrieb, erleichterte. Die Wochen in Villabruna wären noch erholsamer gewesen ohne das allabendliche Heimziehen der Kühe von der Weide, denen meine arme Mutter regelmäßig in der Dorfgasse begegnete. Denn die einzigen Lebewesen, die diese tapfere Frau fürchtete, waren Kühe; vor diesen aber hätte sie, wie mein Vater ihr nachsagte, im Löwenkäfig Schutz gesucht. – Etwas später im Jahr erschien auch Römer auf der Durchreise nach Norden und fügte sich einige Zeit dem ländlichen Leben ein. Er bestand ritterlich ein Kuhabenteuer für die Damen und war mir behilflich, mein deutsches Fahrrad, das noch keine Marke hatte, unter den nachsichtigen Augen der Zollwächter von Le Tezze über die österreichische Grenze zu schmuggeln und es eine Stunde später auf italienischem Gebiet ordnungsmäßig wieder einzuführen. Bald aber trieben seine Nerven den alten Spuk, dass er durch plötzliches Verschwinden ins Gebirg das Haus in Bestürzung versetzte und der warmherzige Alfred ihn voller Schreck da oben suchen ließ, ihm dann aber zusprach, sich schnellstens aus dem Bereich der Glutströme in seine Heimatluft zu retten.
In die Tage von Villabruna fiel eine eigentümliche kleine Episode, die ich nicht mit Stillschweigen übergehen will, weil sie für die einzig große Denkart meiner Mutter kennzeichnend ist wie nichts anderes. Ich erhielt dort eines Tages von unbekannter weiblicher Seite aus einem kleinen badischen Städtchen die Anfrage, ob ich die Tochter von Hermann Kurz sei, die einst beim Stiftungsfest der Universität Tübingen als Muse den Festwagen gelenkt habe; man hätte mir in diesem Falle eine mich sehr nahe betreffende Mitteilung aus dem Leben meines Vaters zu machen, wünschte aber vorher zu wissen, ob meine Mutter noch am Leben sei, um ihr ja keinen Schmerz zu bereiten. Ich ging mit diesem Brief ins Nachbarhaus, wo Mama mit Alfred beisammensaß, und las ihn vor. Hurra, wir haben einen Bruder! rief der ewige Student erfreut. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass es sich um eine Schwester, die Schreiberin selbst, zu handeln scheine, denn eine andere Deutung ließ der Brief meiner Ansicht nach nicht zu. Macht nichts, Bruder oder Schwester, war die Antwort, das Ereignis muss gefeiert werden. Und alsbald stieg der Gute in seinen Keller hinab (wozu er gern die Gelegenheit ergriff) und holte seine letzte Flasche Champagner herauf, um sie selbander auf das Wohl des neuen Geschwisters zu leeren. Mama saß verklärt mit glänzenden Augen; kein kleiner Gedanke kam in ihre Seele, wie dass der Geliebte ihr etwas verhehlt habe, oder gar ein Zug von weiblicher Eifersucht – nichts hasste sie mehr als diese: wenn eine ihrer Freundinnen ihr über einen dunklen Punkt im Vorleben ihres Mannes oder gar über eheliche Flatterhaftigkeit klagte, so wurde sie abgefertigt mit der Mahnung, auch anderen Frauen etwas zu gönnen. Freilich ein Gedanke hätte sie müssen stutzig machen: sie hatte während ihrer Brautzeit wiederholt meinen Vater befragt, ob er nicht, da er lang Junggeselle geblieben, irgendwo ein Kind besitze, sie würde es mit Freuden übernehmen und wie ein eigenes aufziehen; er konnte an der Zuverlässigkeit ihres Wortes nicht zweifeln, denn sie hatte an einem unehelichen Sprößling ihres Erzeugers nach dessen Tode unaufgefordert das gleiche getan. Aber ihr Dichter hatte immer mit Lächeln versichert, dass er nicht dienen könne. Doch an diesen Widerspruch konnte sie jetzt nicht denken. Da war nur eins: ein Kind von ihm, ein unbekanntes! Fünf hatte sie besessen, eines war ihr genommen, jetzt schickte ihr eine gütige Gottheit spät noch den Ersatz. Sie fühlte sich wie Sarah, die im höchsten Alter noch Mutter wird, und breitete innerlich schon weit die Arme aus, um das Geschenkte zu empfangen.
Ich schrieb zurück, dass ich allerdings dieselbe sei und dass ich bitte, sich mir ganz frei und rückhaltlos anzuvertrauen. Meine Mutter lebe und zwar mit mir; sie sei die großherzigste aller Frauen und die zärtlichste aller Mütter, jede Erinnerung an meinen Vater sei ihr heilig und sie habe in ihrem Herzen auch für das Außergewöhnliche Raum; die Schreiberin dürfe überzeugt sein, dass, was immer sie zu sagen habe, eine herzliche und verständnisvolle Aufnahme finden werde. Die Rückantwort brachte eine wunderliche Ernüchterung, schon durch die Anrede »Liebe Cousine« in Verbindung mit der Mitteilung, dass und wieso wir entfernte Verwandte seien (was nahezu alle Württemberger untereinander sind). Dann kam die Enthüllung von dem ehemaligen Verlöbnis meines Vaters mit der Mutter der Schreiberin, das an dem Nein des erhofften Schwiegervaters scheiterte. Die Tochter schien zu glauben, dass die Auflösung des Verhältnisses meinen Vater auf lange Zeit hinaus ebenso unglücklich gemacht habe wie ihre Mutter. Solcher Fälle hatten sich jedoch in seinem Leben eine ganze Reihe ereignet: so oft sich ein Mädchenherz dem schönen und glänzenden jungen Dichter zuwandte, war er bereit, den Herd zu gründen; die betreffenden Schwiegerväter aber fanden, dass der Brennstoff ungenügend sei, und die Töchter entsagten. So ging es auch mit der schönen Lina: sie heiratete auf väterlichen Befehl einen ungeliebten Mann, mit dem ihr Wesen sich nicht verstand, und siechte neben ihm hin, immer des schönen versagten Glückes gedenkend. Es waren die passiven Frauentugenden des Gehorchens und Entsagens, wozu das vorige Jahrhundert die hilf- und willenlose Weiblichkeit erzog. Die arme Glücklose war augenscheinlich von feinerem Holz als ihre Vorgängerinnen, sie trug den Pfeil lebenslang im Herzen und zog sich die Tochter zur Vertrauten heran, damit sie ihr trauern helfe. Ein rührendes kleines Idyll aus biedermeierlicher Enge, aber nicht ohne eine leise Komik im Gegensatz zu der allumfassenden Menschlichkeit meiner Mutter, die etwa an Fürstenhöfen des Mittelalters, wo man die natürlichen Kinder mit der nämlichen Sorgfalt neben den gesetzlichen aufzog, ihresgleichen fand. Welch ein Abstand zwischen diesen bürgerlichen Haustöchterlein, die nichts verstanden als kochen und nähen, und doch nicht wagten, das unsichere Los des Geliebten mit ihrer Fürsorge zu begleiten, und seinem Freifräulein, für die es Himmelsglück bedeutete, dass sie gewürdigt war, seine Entbehrungen und Gefahren zu teilen. – Was ich jener armen Wehrlosen aber wahrhaft übelnahm, war, dass sie auch später als Witwe niemals daran dachte, dem Schwergeprüften ein Zeichen ihres Andenkens, wenn auch nur ein armes Vergissmeinnicht, das ihm vielleicht ein augenblickliches Lächeln abgewonnen hätte, zukommen zu lassen. Auch ihre Tochter erzog sie nicht zu feuriger Begeisterung für den verkannten Dichter, nur zur Mitklage über ihr eigenes verfehltes Los. So verdiente sie auch im Grund nichts Besseres, als dass mein Vater seinem Jugendfreund Kausler gegenüber den ganzen Fall mit der Bemerkung abtat, es sei der dümmste von allen Poetenstreichen gewesen.
Читать дальше