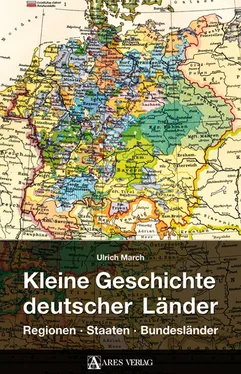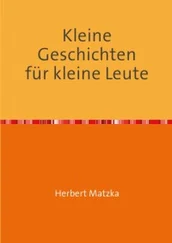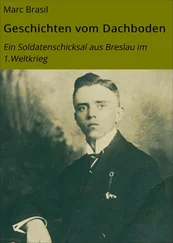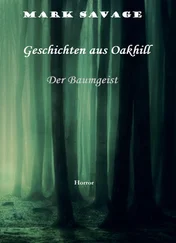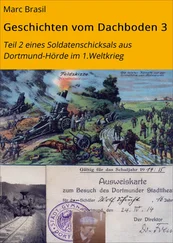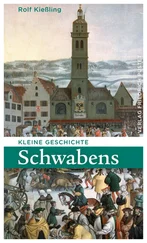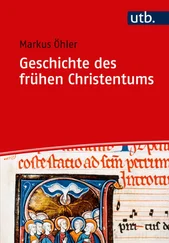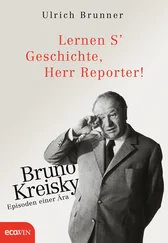Eine knappe Gesamtdarstellung der so verstandenen deutschen Landesgeschichte ist angesichts der kaum überschaubaren Stoffülle nur unter Beschränkung auf bestimmte Schwerpunkte möglich. Bei allem Bemühen, die objektiv wesentlichen Bedeutungszusammenhänge in den Vordergrund zu stellen, lassen sich dabei die Auswahlkriterien naturgemäß nicht völlig von der hier gewählten Betrachtungsperspektive lösen. Wer, um mehr zu erfahren oder diese Perspektive kritisch zu hinterfragen, tiefer in die Materie eindringen möchte, wird weitere landesgeschichtliche Literatur heranziehen müssen, die über das Schriftenverzeichnis erschlossen werden kann.
Die Vielfalt und Komplexität des Materials machen eine klare, übersichtliche Gliederung des Ganzen erforderlich. Die Darstellung ist im großen chronologisch aufgebaut: Jedes der folgenden Kapitel bezieht sich auf eines der historischen Zeitalter, die durch die Epochenjahre 1180, 1648, 1871 und 1945 festgelegt sind (Zeit der Stämme, der Territorien, der souveränen Einzelstaaten, der Länder des Deutschen Reiches und der Bundesrepublik). Die einzelnen Kapitel sind gleichartig aufgebaut: Zunächst werden die Grundzüge der jeweiligen Epoche dargestellt, der Gesamtzusammenhang zwischen regionaler und überregionaler Entwicklung. Es folgt dann – jetzt nicht mehr zeitlich, sondern räumlich geordnet – ein allgemeiner Überblick über die Länder der betreffenden Epoche. Schließlich werden in einer Reihe von Einzelabhandlungen, ebenfalls in geographischer Anordnung, solche Länder und Regionen besonders hervorgehoben, die in der Epoche nationale oder europäische Geltung erlangt haben.
Das Aufbauprinzip der einzelnen Kapitel lehnt sich an die naturräumliche und siedlungsgeographische Gliederung des deutschen Sprachgebietes an, das sich über drei Großregionen erstreckt: über die Norddeutsche Tiefebene, die Mittelgebirgsregion und die Alpen einschließlich ihres nördlichen Vorlandes. Von den sechs „Altstämmen“, aus denen sich das deutsche Volk gebildet hat, besiedeln je zwei eine dieser Großregionen: die Friesen und (Nieder-)Sachsen den Norden, die Franken und Thüringer die Mitte und die Alemannen und Bayern den Süden. Östlich der Siedlungsgebiete dieser Stämme schließt sich das ehemals slawische Neusiedelland jenseits von Elbe, Saale, Bayerischem Wald und Enns an, das im Zuge der Ostsiedlung im Norden bis zur Memel, im mitteldeutschen Bereich bis Oberschlesien und im Süden bis zur Ostgrenze des Burgenlandes ausgedehnt wird.
In allen Kapiteln werden zunächst der Nordraum, dann die Mitte und zum Schluß der Süden behandelt. Innerhalb dieser drei Großregionen schreitet die Darstellung von West nach Ost fort, so daß sich insgesamt folgende Reihenfolge ergibt:
1.Friesische Länder (Küstenregion der Nordsee)
2.Niedersächsische Länder (Nordwestdeutschland einschließlich Westfalen und Sachsen-Anhalt)
3.Länder des nordostdeutschen Neusiedelgebietes (Küstenraum der Ostsee)
4.Fränkische Länder (fränkisches Siedlungsgebiet im weitesten Sinne: rheinische, moselfränkische und rheinfränkische Gebiete, Hessen, Mainfranken)
5.Thüringen
6.Ostmitteldeutsche Länder (Neusiedelgebiet östlich der Saale)
7.Schwäbisch-alemannische Länder (Südwestdeutschland und der angrenzende Alpenraum)
8.Bayern (mittlerer Alpen-Donau-Raum)
9.Österreich (östlicher Alpen-Donau-Raum)
Berücksichtigt ist nur das geschlossene deutsche Sprachgebiet, nicht also das Baltikum und Böhmen, obwohl beide Regionen viele Jahrhunderte lang Anteil an der deutschen Geschichte haben. Selbstständig gewordene oder abgetretene Gebiete bleiben im allgemeinen vom Zeitpunkt ihres Ausscheidens an außerhalb der Betrachtung, doch werden die Geschichte der Schweiz seit 1648 und die Österreichs seit 1866 in einem Exkurs dargestellt.
II. Stammesstaaten (bis 1180)
1. Die Stämme, das Königtum und das Imperium
Vor Mitte des ersten Jahrtausends ist es im heutigen Deutschland zu keinen großräumigen Herrschaftsbildungen gekommen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung siedeln hier zahllose germanische Kleinstämme. Eine Zentralgewalt gibt es nicht; die römische Herrschaft endet an Rhein, Limes und Donau. Seit Anfang des dritten Jahrhunderts verschwinden die bisherigen Stammesverbände; an ihre Stelle treten Großstämme, von denen sechs – Friesen, Franken, (Nieder-)Sachsen, Thüringer, Alemannen und Bayern – bis zum heutigen Tag die Teilethnien des deutschen Volkes bilden. Die neuen Stämme organisieren sich als Personenverbände; die wichtigsten politischen Organe sind die Stammesversammlung, der Stammesherzog und – auf unterer Ebene – die Gauversammlungen. Erst mit der Ostexpansion des fränkischen Großreiches, das seinen Schwerpunkt in Nordfrankreich hat, ändern sich die Verhältnisse. Die Franken unterwerfen zunächst die Thüringer, dann die Friesen und die Alemannen, im Zeitalter Karls des Großen (768–814) schließlich auch die Bayern und die Sachsen. Zum ersten Mal gehört alles Land bis zur Slawengrenze an Elbe, Saale und Enns einem gemeinsamen staatlichen Verband an, dessen König über seine Grafen, die Inhaber des Königsbanns auf unterer Ebene, seinen Willen zur Geltung bringt.
Aber wie später noch sooft in der deutschen Geschichte, wie noch während der nationalsozialistischen und kommunistischen Diktatur des 20. Jahrhunderts, sind die regionalen und föderalen Potenzen nur zeitweilig durch die Zentralgewalt überlagert, nicht wirklich beseitigt worden. Sie leben sofort wieder auf, als die spätkarolingischen Könige, durch die Reichsteilung von Verdun (843) geschwächt, bei der Abwehr der gerade damals besonders aggressiven Ungarn, Slawen und Normannen versagen. Es kommt – vom Rhein-Mosel-Gebiet abgesehen – überall zur Renaissance der alten Stammesstaaten, wobei in der Regel ein Angehöriger einer im Abwehrkampf besonders bewährten Familie die Herzogswürde übernimmt und eine regionale Machtstellung erringt, gegenüber der die Zentralgewalt in den Hintergrund tritt.
An dieser machtpolitischen Konstellation ändert sich zunächst auch nach Beginn der eigentlichen deutschen Geschichte noch nichts. Das Deutsche Reich, das sich 911 durch die Wahl des Frankenherzogs Konrad zum König als eigenständiger Nachfolgestaat des Frankenreiches konstituiert, ist eine lockere und äußerst labile Konföderation von Stammesherzogtümern; König Konrad I. (911–919), ohnehin nur „primus inter pares“, kann sich zu keinem Zeitpunkt außerhalb seines eigenen Herzogtums durchsetzen.
So sind also bereits bei Beginn der deutschen Geschichte die politischen Gewichte eindeutig zugunsten der Regionalgewalten verteilt; ein Zerfall der eigentlich nur nominellen königlichen Zentralgewalt und damit langfristig die Balkanisierung Mitteleuropas hätte durchaus im Bereich des historisch Möglichen gelegen.
Daß es anders gekommen ist, verdankt Deutschland dem politischen Wirken einer ganzen Reihe von Königen, unter denen vor allem die beiden ersten Ottonen, Heinrich I. (919–936) und Otto der Große (936–973), der Salier Konrad II. (1024–1039) und der Staufer Friedrich Barbarossa (1152–1190) hervorzuheben sind. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts gewinnt das Königtum die politische Prärogative gegenüber den Regionalgewalten und entwickelt auch in der Folgezeit eine so starke Eigendynamik, daß die Stammesstaaten demgegenüber in den Hintergrund treten, fortlaufend schwächer werden und schließlich um 1200 erneut als politische Einheiten verschwinden.
Doch wiederum sind die regionalen Kräfte keinesfalls ausgeschaltet; trotz aller Kaiserherrlichkeit kann von einem Weg in einen wie auch immer gearteten Zentralstaat keine Rede sein. Erben der Stammesherrschaft sind schließlich nicht die Könige und Kaiser, sondern die fürstlichen Landesherren, deren Territorien sich seit dem 10. Jahrhundert sehr stark entwickeln. Ihre Stellung beruht vielfach auf Grundlagen, die das Königtum, um Gegengewichte gegen die Stammesgewalten zu errichten, seit dem 10. Jahrhundert selbst geschaffen hat. Das ist beispielsweise bei den geistlichen Reichsfürsten der Fall, denen seit Otto dem Großen erhebliche politische Befugnisse übertragen worden sind.
Читать дальше