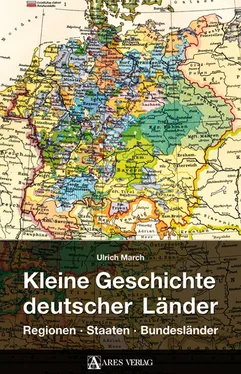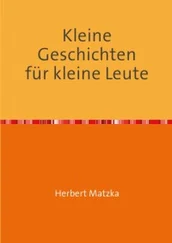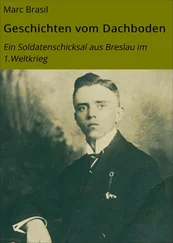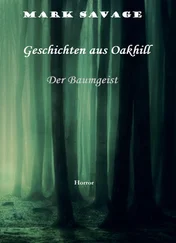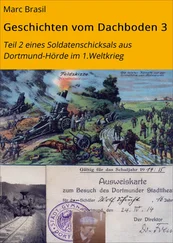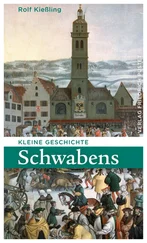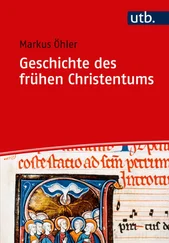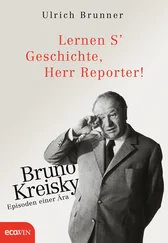1.Für Kirche und Reich (10.–12. Jahrhundert)
2.Königsland am Rhein (11. Jahrhundert)
3.Umbruch in der „Pfaffengasse“ (14.–16. Jahrhundert)
4.Im Schatten der „Grande Nation“ (17.– 19. Jahrhundert)
5.Weinland an Rhein und Mosel (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Saarland
1.Zwischen den „Erbfeinden“ (19./20. Jahrhundert)
2.Grenzland im Wandel (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Hessen
1.„Reben und Messegeläut“ (8.–12. Jahrhundert)
2.Umbruch in der „Pfaffengasse“ (14.–16. Jahrhundert)
3.„Hessen vorn“ (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Thüringen
1.Wiege der Reformation (16. Jahrhundert)
2.„Weimar als Symbol der Welt“ (Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert)
3.Das „Grüne Herz“ Deutschlands (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Sachsen
1.Barockkultur an der Elbe (18. Jahrhundert)
2.Freistaat an der Elbe (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Baden-Württemberg
1.Territoriale Basis für große Politik (12./13. Jahrhundert)
2.Kirche und Kultur im Alpenrandraum (7.–13. Jahrhundert)
3.„Alte deutsche Freiheit“ (13.–18. Jahrhundert)
4.Im Schatten der „Grande Nation“ (17.–19. Jahrhundert)
5.Schaffendes „Ländle“ (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Bayern
1.Block in der deutschen Geschichte (6.–12. Jahrhundert)
2.Kirche und Kultur im Alpenrandraum (7.–13. Jahrhundert)
3.„Alte deutsche Freiheit“ (13.–18. Jahrhundert)
4.Brennspiegel des alten Reiches (17./18. Jahrhundert)
5.Im Schatten der „Grande Nation“ (18./19. Jahrhundert)
6.Kontrapunkt im Süden: „München leuchtet“ (19. und Anfang 20. Jahrhundert)
7.„Unterm Himmel weiß und blau“ (seit Mitte 20. Jahrhundert)
Landesgeschichtsforschung ist wie Mikroskopieren oder Tiefseetauchen: sobald man sich ernsthaft damit beschäftigt, eröffnet sich eine bunte, faszinierende Welt, die einen eigentümlichen Reiz ausübt. Besonders das alte Reich, das nicht ohne Grund als verfassungsrechtliches „Monstrum“ gesehen wurde, weist eine solche Fülle bizarrer, ständig wechselnder Herrschaftsbildungen auf, daß sich der Betrachter wie beim Blick in ein Kaleidoskop vorkommt. Eintausendsiebenhundertneunundachtzig rechtlich selbstständige politische Einheiten sollen es zuletzt gewesen sein: europäische Großmächte wie Preußen oder Österreich, aber auch reichsunmittelbare Städte mit nur einigen hundert Einwohnern, Reichsritterschaften von weniger als einem Quadratkilometer Gesamtfläche und sogar Reichsdörfer mit nur einer Handvoll Bauernstellen. Prachtvolle Residenzen mit luxuriöser Hofhaltung hat es gegeben, etwa Dresden zur Zeit Augusts des Starken, häufiger aber noch Miniaturfürstentümer, deren Herrscher ihren Lebensunterhalt nur in fremden Diensten sicherstellen konnten, beispielsweise der Vater Katharinas der Großen, Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, der bei der Geburt seiner Tochter, der späteren Zarin, preußischer Stadtkommandant von Stettin war.
Bei den geistlichen Fürstentümern, den Freien Reichsstädten und den Bauernrepubliken zeigt sich die gleiche Bandbreite: Auf der einen Seite gab es die mächtigen, kulturell anspruchsvollen Fürstbistümer an Rhein und Main, Städte von hohem wirtschaftlichen und geistigen Rang wie Nürnberg oder Straßburg und reiche, selbstbewußte Marschenrepubliken wie Dithmarschen oder die Friesischen Lande, auf der anderen Seite völlig unbedeutende Reichsabteien, kümmerliche Ackerbürger-Städte oder entlegene „Waldstätten“ wie die drei Schweizer Urkantone.
Diese verwirrend-vielfältige Welt, die sich keine Phantasie farbiger ersinnen könnte, ist konkrete historische Wirklichkeit. Üblicherweise spricht man von Landesgeschichte, wobei dieser Begriff sowohl das regionale Geschehen selbst als auch eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft bezeichnet. Dabei unterscheidet man zwischen der Landesgeschichte einer bestimmten Region, also etwa der des Landes Tirol oder des Elbe-Saale-Raumes, und allgemeiner Landesgeschichte im Sinne von zusammenfassender Regionalgeschichte eines Großraums, etwa der Landesgeschichte Frankreichs oder Deutschlands.
Eine politisch-historische Region wird im Deutschen überwiegend als „Land“ bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf die frühen „Personenverbandsstaaten“ (Gaue, Stammesherzogtümer) ebenso wie auf die späteren Territorien und auf die Gliedstaaten der modernen Föderationen (Reichs- und Bundesländer). Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unterscheidet man zwischen geistlichen und weltlichen Ländern, ferner zwischen Herzogtümern, Markgrafschaften, Kurfürstentümern, Grafschaften (auch Land- und Pfalzgrafschaften), Fürstentümern und kleineren reichsunmittelbaren Herrschaften, zu denen neben Reichsritterschaften und Reichsstädten auch die Bauernrepubliken des westlichen Alpengebiets und der Nordseeküste gehören.
Alle diese „Länder“ haben ihre eigene Legitimation und ihre eigenen Kompetenzen und spielen grundsätzlich eine doppelte historische Rolle: Sie besitzen einerseits ihre eigene Geschichte, und sie nehmen andererseits teil an der allgemeinen Entwicklung in Deutschland – dies umso mehr, als die politische Vorstellungswelt nahezu ununterbrochen im Zeichen des föderalen Staatsgedankens steht und die einzelnen Länder sich in aller Regel als Teile eines größeren Ganzen empfinden. Deutsche Geschichte verläuft somit prinzipiell zweigleisig, nämlich auf regionaler und nationaler Ebene zugleich, wobei letztere sich keinesfalls mit dem deutschen Siedlungsgebiet zu decken braucht. Aufs Ganze gesehen, ist der regionale Einfluß auf die nationale Entwicklung beträchtlich; vor der Mitte des 10. Jahrhunderts und dann wieder vom 14./15. bis zum 19. Jahrhundert fallen die Entscheidungen überwiegend in den Regionen.
Die Einwirkung der Länder auf die jeweilige Zentrale vollzieht sich in doppelter Weise: Einmal sind die beiden Ebenen institutionell miteinander verklammert; so ist etwa durch den alten Reichstag, das Kurfürstenkollegium oder den heutigen Bundesrat, mehr noch durch den des Bismarckreiches gewährleistet, daß die Länder unmittelbar an der Gestaltung der nationalen Politik beteiligt sind. Zum anderen wird die obere Ebene von der unteren ständig wie aus einem unerschöpflichen Reservoir gespeist, da ununterbrochen geistige und politische Kräfte regionaler Herkunft, verkörpert in einzelnen Personen oder Personengruppen, etwa Angehörigen von Dynastien oder Funktionseliten, in allgemeine Zusammenhänge hineinwachsen und nationale Geltung erlangen.
Im Zeitalter der europäischen Einigung liegt es nun nahe, die Perspektive noch mehr auszuweisen und neben der nationalen auch die kontinentale Ebene ins Auge zu fassen. Wir erkennen heute klarer als frühere Generationen, daß rein nationale Geschichtsbetrachtung häufig zu kurz greift, da die Geschichte der europäischen Völker engstens mit der des gesamten Kontinents verflochten ist. Dessen Entwicklung läßt keine seiner Teilregionen unberührt; umgekehrt ist die Geschichte besonders der großen Völker zum guten Teil auch europäische Geschichte. Soweit also die deutschen Regionen die nationale Geschichte beeinflussen, wirken sie zugleich über diese hinaus.
Daneben entwickeln manche historische Regionen Deutschlands zeitweilig auch direkten Einfluß auf die Geschichte des europäischen Auslands, etwa infolge dynastischer Verwandtschaftsbeziehungen oder staatsrechtlicher Verbindungen wie der hannoversch-englischen, sächsisch-polnischen oder schleswig-holsteinisch-dänischen Personalunion. Jedenfalls haben die deutschen Länder die europäische Geschichte in stärkerem Maße mitgeprägt als etwa manche am Rand gelegenen Kleinstaaten des Kontinents. Deutsche Landesgeschichte hat demnach neben der regionalen und der nationalen noch eine dritte Dimension: die europäische.
Читать дальше