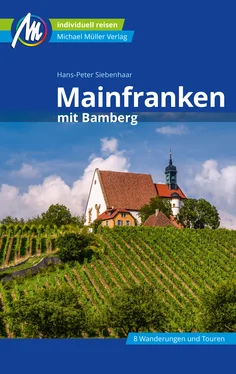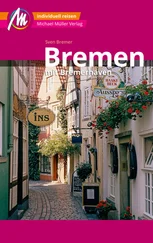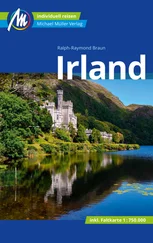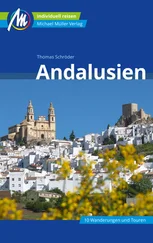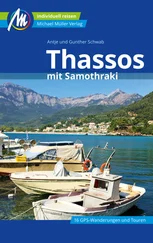Wo essen gehen?
Um es gleich vorwegzunehmen, Bamberg ist kein Feinschmeckerparadies. Das hat einen Grund: Zum heimischen Bier passt am besten eine deftige Küche. Und diese wird in Bamberg gepflegt.
Keller Wilde Rose: Der Spaziergang hinauf auf den Stephansberg kann durchaus schweißtreibend sein. Doch am Ziel entschädigt der Brauerei-Keller mit viel Schatten unter Kastanienbäumen und vor allem mit gutem Bier. Leider Selbstbedienung.
Brauergasthof Höhn: Der Familienbetrieb braut seit über 200 Jahren gutes Bier und serviert dazu eine überdurchschnittliche Küche. Ideal für den kulinarischen Ausklang eines Ausflugs zum nordöstlich von Bamberg gelegenen Memmelsdorfer Schloss Seehof.

Das historische Brückenrathaus ist das Wahrzeichen Bambergs
Bamberg und seine Viertel
Der „heilige Bezirk“ der Stadt zieht sich am westlichen Ufer der Regnitz den Hang hinauf. Hier konzentrieren sich Klosterbauten, prunkvolle Bischofsresidenzen, Paläste des Geldadels und der mächtige Dom - eine steinerne Machtdemonstration der absolutistischen Fürstbischöfe. Aus vielen Ecken, Winkeln und Eingängen blicken Madonnen hervor, 200 sind es allein im historischen Zentrum. Im Dom ruht Papst Clemens II. in einer Gruft - das einzige Grab eines Pontifex maximus nördlich der Alpen. Nebenan der schönste aller Bamberger Höfe - die Alte Hofhaltung: holpriges Kopfsteinpflaster, Stein, Holz und Fachwerk unter einem gotischen Steildach.
Mittelpunkt Bambergs ist heute die Fußgängerzone um den Grünen Markt und den Maxplatz. Auch wenn die Innenstadt als Einkaufsort angesichts der Parksituation und der Konkurrenz der Einkaufsmärkte am Stadtrand gelitten hat, lohnt sich unbedingt ein Bummel. Der Maxplatz wurde zwar kaputt modernisiert, doch steht hier das Neue Rathaus mit seiner barocken Fassade. Gleich daneben, in Richtung des linken Regnitzarms, liegt der Grüne Markt mit der barocken St.-Martins-Kirche von 1693. Wochentags drängen sich die Menschen zwischen den dicht stehenden Ständen der Obst- und Gemüsebauern. Am Platz steht auch das originelle Wahrzeichen der Stadt, der Neptunbrunnen „Goblmo“ (Gabelmann), im Sommer der Jugendtreff.
Der Hain ( → Unterwegs in der Stadt) ist ein Villengebiet unmittelbar neben der Altstadt. Die malerische Lage am gleichnamigen Park mit seinen Freizeiteinrichtungen von Schwimmbad über Ruderklub bis Tennisverein machen das Stadtviertel zu einem bevorzugten Wohngebiet. Die Gärtnerstadt jenseits des Rhein-Main-Donau-Kanals (RMD) hat sich bis heute ihre kleinstädtische Struktur bewahren können. Bamberg hat eine große Gartenbautradition. Die knollige Kartoffel mit dem Namen Bamberger Hörnla genießt auch außerhalb Frankens einen exzellenten Ruf.
Geschichte
Bambergs Urzelle war das „Castrum Babenberg“ im Bereich des heutigen Doms. Die Anfänge dieser karolingischen Siedlung reichen bis ins 8. Jh. zurück. 997 begann der spätere deutsche König Heinrich II. (ab 1002) mit dem Ausbau der Burg. 1007 wurde sie zum Sitz eines neu gegründeten Bistums erhoben, dem die älteren Diözesen Würzburg und Eichstätt Gebiete abtreten mussten. Bevor er 1046 zum Papst gewählt wurde, war Clemens II. hier Bischof. Bamberg stieg in dieser Zeit zu einer der wichtigsten Städte des Heiligen Römischen Reiches auf. Wiederholt fanden an der Regnitz Reichstage statt.
Vermutlich zu Beginn des 13. Jh. wurde auf den Fundamenten der beiden vorausgegangenen (abgebrannten) Dombauten der Grundstein für das heutige Bauwerk gelegt; die Einweihungsfeierlichkeiten fanden im Mai 1237 statt.
Fischerstechen auf der Regnitz
Die Fischerstecher, bewaffnet mit vier Meter langen Holzstangen, balancieren auf dem Bug der langen, schmalen Kähne. Der Fahrer des Bootes muss sich dabei möglichst ruhig fortbewegen, nicht ruckartig, denn sonst wird sein Kompagnon eine leichte Beute für den Gegner und in den Fluss gestoßen. Alljährlich Ende August zur Sandkerwa, dem größten Volksfest der Region, treten die Besten zum Wettbewerb an. Die Sandstraße verwandelt sich während der Kirchweih in eine kilometerlange Theke. Die Sandkerwa ist übrigens kein von oben verordnetes Fest, sondern wurde von den Bürgern im Jahr 1950 aus der Taufe gehoben. Vielleicht erklärt das ihre Beliebtheit. Jeweils am Montag gegen 22 Uhr steigt ein prächtiges Feuerwerk in den Himmel, das Zehntausende in die Altstadt und an das Regnitzufer lockt. Im Jahr 2015 gab auf dem Wasser ein ganz besonderes Gefährt: Der fränkische Milliardär Michael Stoschek war während der Sandkerwa ungenehmigt mit einem Amphibienfahrzeug auf der Regnitz unterwegs. Der Chef des Automobilzulieferers Brose, der die Aufregung um seine Aktion nicht verstand, musste für seine Aktion ein Bußgeld von 200 Euro zahlen (für seine Idee eines Kfz-Klebekennzeichens musste er dagegen eine Geldbuße von 150.000 Euro zahlen).
Die Bürgerschaft siedelte zuerst auf dem schmalen Streifen zwischen dem linken Regnitzarm und dem Berggebiet. Anfang des 12. Jh. wuchs die Stadt in den Bereich der heutigen Innenstadt hinein. Höhepunkt der städtischen Entwicklung war der Bau des Rathauses im 14. Jh. In den folgenden Jahrhunderten kam es ständig zu Auseinandersetzungen zwischen Geistlichkeit und Bürgerschaft, denn die Privilegierten des „heiligen Bezirks“ wollten sich nicht an den Baukosten für eine sichere Wehranlage beteiligen.
Von 1612 bis 1630 regierte der Hexenwahn die Stadt. Bischof Georg Fuchs von Dornheim und sein Weihbischof Friedrich Förner ließen in besonders eingerichteten Kammern 600 Menschen foltern und anschließend umbringen, darunter den Bürgermeister.
Die Wende kam Anfang des 18. Jh. mit den bauwütigen Bischöfen von Schönborn. Unter ihrer Herrschaft erhielt die Stadt das bis heute prägende barocke Gewand. Es wurde viel abgerissen, renoviert, umgestaltet - Bamberg erlebte seine große kulturelle Blütezeit.
1796 wurde die Stadt, wie ganz Süddeutschland, von der französischen Revolutionsarmee erobert. Ein folgenreiches Ereignis, denn 1803 ging Bamberg mit seinem Bistum als Entschädigung an Bayern.

Der Bamberger Dom ist nie fertig
Zu Beginn des 20. Jh. wurde Bamberg kurzzeitig sogar zu dessen Hauptstadt, als die 1919 aus München vor der Rätebewegung geflüchtete bayerische Regierung mit ihrem ersten demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Hoffmann in der Domstadt Zuflucht fand. Die Neue Residenz wurde Regierungssitz, im Gerichtsgebäude kam das Justizministerium, im Bahnhof das Verkehrsministerium unter. Die Sitzungen hielt der Landtag in den Harmoniesälen am Schillerplatz ab. Am 12. August 1919 wurde dort die „Bamberger Verfassung“ verabschiedet, die bis zur Machtübernahme der Nazis in Kraft blieb. Das 95 Artikel umfassende Werk war die erste demokratische Verfassung Bayerns. Sie gilt noch heute in vielerlei Hinsicht als modern. So sah sie Volksbegehren und Volksentscheide vor und gestand jedem Bürger den „Anspruch auf eine angemessene Wohnung“ zu.
Читать дальше