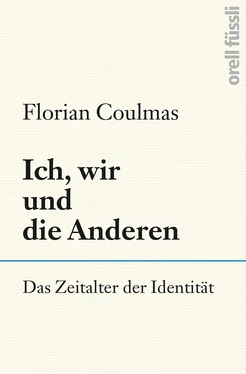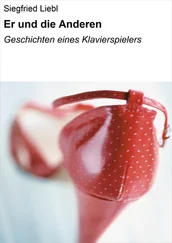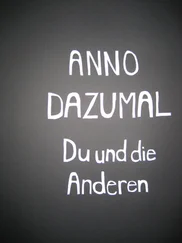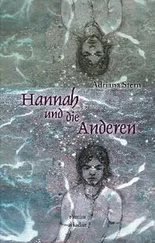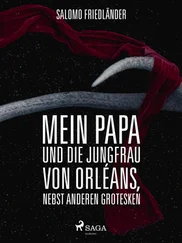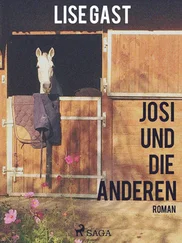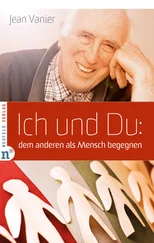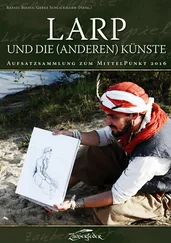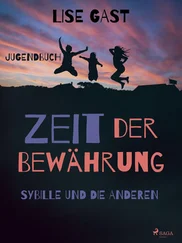Geschlecht, so denken viele, die unter dem Einfluss der herrschenden Lehre aufwuchsen und nie darüber nachgedacht haben, was könnte natürlicher sein? Selbst Freud, der alles vom Lustprinzip und von der Gesellschaft wusste, lehrte, dass in punkto Geschlechteridentität kein Weg an der Anatomie vorbeiführt. Und Geschlechter gibt es zwei, das bestätigt die Alltagserfahrung auf Schritt und Tritt. Die praktischen Dinge des gesellschaftlichen Lebens beruhen auf einer binären Geschlechtereinteilung – rosa oder hellblau –, die, da sie ja zweifellos etwas mit der Natur zu tun hat, als natürlich erscheint. In Indien haben die Hijra zwar einen festen Platz in der Gesellschaft, und schon alte Sanskrit-Texte erwähnen Männer und Frauen, die in heutiger Diktion eine intersexuelle Identität haben. In Thailand sieht die dort mehrheitlich praktizierte Schule des Buddhismus eine dreipolige Geschlechtereinteilung in Frauen, Männer und Kathoey vor. Auch die Philosophie des Taoismus aus China tritt der Vielfalt sexueller Orientierungen traditionell offen und duldsam gegenüber. Aber wer schaut schon nach Asien, wo wir in Europa doch Toleranz und Fortschritt gepachtet haben?
Dass der deutsche Bundestag und das Bundesverfassungsgericht mit der Anerkennung eines dritten Geschlechts und der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe endlich mit den Hindus und Taoisten gleichgezogen haben, ist vermutlich eine Sicht der Dinge, die nicht alle Abgeordneten und Richter teilen. Der Hinweis auf andere Traditionen ist jedoch lehrreich, da er unseren Blick darauf lenkt, dass der Mensch ein autokreatives Wesen ist, das der Natur nicht blind gehorcht, sondern sie formen will. Das muss nicht gleich die Ersetzung der Sexualität durch medizinische Reproduktionstechnologie bedeuten, wie sie von Vertretern des Post-Genderismus propagiert wird. Aber die zunehmende Bereitschaft des Menschen, Schicksal durch Gestaltung zu ergänzen, ist nicht zu übersehen.
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und die damit vollzogene Enttabuisierung der Intersexualität exemplifiziert diesen Gestaltungswillen. Den Weg dorthin bereiteten Frauen, denn, weil sie es buchstäblich am eigenen Leibe erfuhren, erkannten sie früher als Männer, dass Geschlecht Gegenstand gesellschaftlicher Normierung ist. Sie wussten, dass ihr Geschlecht kein Grund sein durfte, ihnen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft eine inferiore Stellung zuzuweisen. Dafür gingen ihre Vorkämpferinnen, Suffragetten und Blaustrümpfe, auf die Straße. Gleichberechtigung bei Wahlen war das erste Ziel, das 1906 in Finnland erreicht war, 1918 in Deutschland und – gut Ding will Weile haben – 1971 in der Schweiz.
Die Frauenbewegung machte Geschlechteridentität zu einem wichtigen Thema, wobei die Kritik der binären Geschlechtereinteilung allerdings keine Rolle spielte. Es ging zunächst darum, dass Verschiedenheit nicht mit Unterordnung einhergehen sollte, womit ein Grundsatz jeder Identitätsdebatte formuliert war. Weiterhin ging es um das Verhältnis von Biologie und Soziologie, also darum, was naturgegeben und was gesellschaftlich konstruiert ist. Darüber wurde mit Crescendo gestritten, was zu der konzeptuellen Trennung von biologischem Geschlecht, Sex , und sozialem Geschlecht, Gender , führte. Diese Unterscheidung ist heute geläufig, wurde in breiteren Kreisen jedoch erst in den 1970er Jahren bekannt.
Dass zwischen biologischem und sozialem Geschlecht ein Unterschied besteht, ist weithin akzeptiert, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten über das Verhältnis zwischen beiden gibt. Der radikalsten, von der Philosophin Judith Butler vertretenen These zufolge besteht zwischen Sex und Gender keinerlei Kausalzusammenhang. Die Geschlechtsidentität beruht danach nicht auf einer körperlichen Grundlage, die geistig überformt wird, sondern ist ein rein soziales Konstrukt. Andere Ansätze gestehen zu, dass das Verhalten zwischen den Geschlechtern zwar soziokulturell geprägt ist, beharren aber darauf, dass Frauen Frauen und Männer Männer sind und die Einteilung nach dem biologischen Geschlecht aufgrund der geschlechtlichen Fortpflanzung nicht willkürlich ist. Das gelte für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung und schließe die Anerkennung der Existenz trans- und intersexueller Personen nicht aus.
Der obige kursorische Hinweis auf andere Kulturen zeigt, dass die gesellschaftliche Bedeutung des Geschlechts historisch zufällig ist. Jede Antwort auf die Frage, wie sich natürliches und soziales Geschlecht zueinander verhalten, wird daher zwangsläufig normativ sein. Es ist eine politische Frage, um die weiter gestritten wird. Ein wichtiger Schauplatz dieses Streits ist der Arbeitsmarkt. Die Emanzipationsbewegung der Frauen hat die Rollenverteilung »Brotverdiener – Hausfrau« zum Auslaufmodell gemacht und dazu geführt, dass die Segregation von Berufsfeldern nach Geschlecht und überkommenen Stereotypen abgebaut wurde. »Gleiche Arbeit, gleicher Lohn!« war und ist der Schlachtruf.
Heute gibt es Lastwagenfahrerinnen und Pilotinnen, Krankenpfleger und Erzieher; die Erwerbsquote der Frauen in Deutschland ist von 47,6 Prozent in 1960 auf 73,4 Prozent in 2016 gestiegen; Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind geringer geworden. Gehen diese Veränderungen auf das Haben-Konto der feministischen Bewegung? Oder reflektiert die feministische Gesellschaftskritik ökonomische Notwendigkeiten? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Sie zu stellen, ist trotzdem nicht müßig, denn mit Karl Marx können wir zwar zugeben, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, aber in unserer hochkomplexen Gesellschaft ist es äußerst schwierig geworden, eine scharfe Trennlinie zwischen Sein und Bewusstsein zu ziehen.
Der Umgang mit der Geschlechteridentität macht das überdeutlich. Die traditionelle christliche Moral pochte auf die natürliche Identität – das Sein. Die Frauen, die Geschlechterdiskriminierung zu Thema machten, betonten demgegenüber den sozial konstruierten Charakter der ihnen zugeschriebenen Identität – das Bewusstsein. Und die LGBTQs, die auf den von den Feministinnen angeschobenen Zug aufsprangen, um die Anerkennung ihrer Identität zu fordern, brachten unter Rekurs auf genetische Forschung die Biologie, das Sein, zurück in die Debatte. Als autokreative Wesen schwanken wir immer zwischen Sein und Bewusstsein. Was wir sind, unsere Identität, können wir nicht wählen; was wir sein wollen, unsere Identität, aber schon. Der Begriff der Identität selber erschwert es, beides zu bejahen und wird dadurch diffus.
Sowohl den Frauen als auch den Trans- oder Intersexuellen geht es, wenn sie über Identität sprechen, um Achtung und Selbstachtung, um Anerkennung und Gleichbehandlung, kurz: um Differenz ohne Diskriminierung. Dieses auf der Grundidee der Menschenrechte fußende Prinzip ist bisher allenfalls ansatzweise realisiert worden und wird nach wie vor vielfach aufs Gröbste missachtet. Das erweist sich nirgend schmerzhafter als in der Kakophonie des Rassismus, die zum Schweigen zu bringen, noch immer nicht gelungen ist.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.