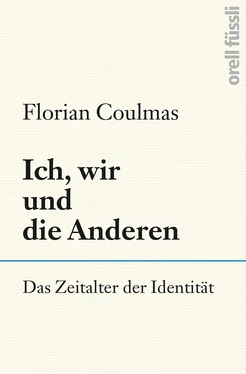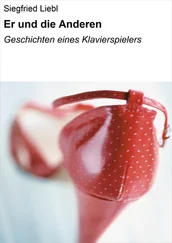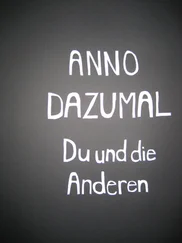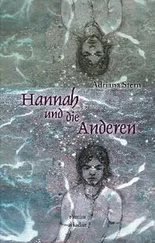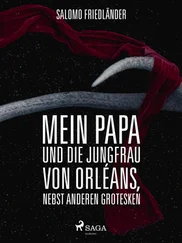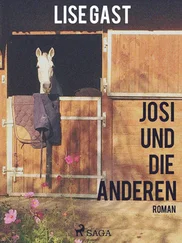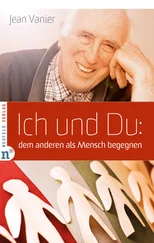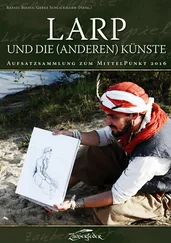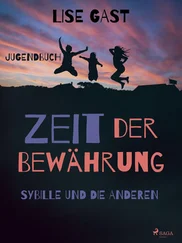Leichter haben es diejenigen, die eine der für das gesellschaftliche Leben wichtigsten Fähigkeiten erlernt haben, die Fähigkeit nämlich, Identität darzustellen, Identitätsakte zu vollziehen. Das ist es, was uns nach Auffassung mancher Psychologen, die Identität als relational verstehen, in einer Gesellschaft abverlangt wird, in der Status nicht schicksalhaft, da erblich ist. Wir selber sind es, die unser wahres Selbst in der Beziehung zu anderen herauskehren und damit überhaupt erst konstruieren. Das so überaus wichtige Konzept der Selbstverwirklichung besagt eben dies; es verlangt von uns aktiven Einsatz. Nicht durch Demut und Vertrauen in den Lauf der Dinge kommen wir in der Welt voran, sondern durch Arbeit an uns selbst, durch wohlüberlegte Entscheidungen, durch Einstudieren und Proben, kurz, durch die Inszenierung des Auftritts, den wir heute Vormittag beim Kundengespräch, später mit dem neuen Abteilungsleiter und am Abend im Restaurant mit der Angebeteten haben werden.
Shakespeare wusste das in seiner Komödie
»Wie es euch gefällt« schon vor vierhundert Jahren:
Die ganze Welt ist Bühne
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und gehen wieder ab,
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen
Durch sieben Akte hin.
Nicht jeder und jedem liegt freilich das Rollenspiel, was in einer Gesellschaft, in der alle dem Ranking und Rating ausgesetzt sind, ein Grund dafür ist, dass manche besser vorankommen als andere. Wer die Dinge laufen lässt, hat keine guten Chancen. Im Kleinen – zum Beispiel im Supermarkt beim Einkaufen – wie im Großen – zum Beispiel bei der Stellensuche oder bei der Vergabe von Aufträgen – sind wir ständig gefordert, auszuwählen und Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet Freiheit, aber eben auch Qual, die sich etwa darin äußert, was Psychologen Entscheidungsmüdigkeit nennen. Entscheidungen zu fällen kostet Energie, denn damit wird die Fähigkeit in Anspruch genommen, sich selbst zu beherrschen. Wenn diese Energie erschöpft ist, leidet der Mensch unter Entscheidungsmüdigkeit und trifft deshalb unter Umständen die falsche Entscheidung.
Eine Grundannahme der individualistischen Gesellschaft ist es, dass jeder Mensch eine Identität hat, ein ureigenes Wesen, das unabhängig von prägenden Faktoren der Umwelt – Rasse, Religion, Klasse u. a. – in die er hineingeboren wird, existiert. Wachsender Wohlstand in der westlichen Welt seit dem zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr erlauben können, im materiellen wie im übertragenen Sinne. In den hippen 1960er und 70er Jahren entstanden unkonventionelle Familienstrukturen, und immer mehr Menschen entschieden, dass bürgerlicher Konformismus nicht die einzige Leitlinie im Leben sein sollte. Gleichzeitig wurde das Warenangebot immer bunter und zwang uns dazu, auszuwählen. Und die Toleranz für Vielfalt, nach der jeder sein »wahres Selbst« ausleben können soll, nahm nicht nur zu; die Freiheit, dieses Selbst zu realisieren, es auszuleben, ist zu einem kategorischen Imperativ geworden. Das bedeutet wiederum Entscheidungen darüber, wie dieses Selbst in eine präsentable Identität auf der Bühne der Gesellschaft darzustellen ist: Freiheit für alle!
Dass dieser Imperativ manche überfordert, bezeugen die Leiden der jungen Werthers von heute, die sich tanzend den »Snakes« oder den »Dead Boys« überlassen oder von einer Identitätskrise heimgesucht werden. Sie ziehen sich von der Bühne der Gesellschaft zurück oder betreten sie gar nicht erst: die Heranwachsenden, die unter Sozialphobie leiden, die NEETs ( Not in Education, Employment or Training ) Jugendliche ohne Schul- oder Berufsausbildung und Anstellung, die italienischen bamboccini (erwachsenen Babys) und die japanischen hikikomori , die sich jahrelang in ihr Zimmer einschließen und mit niemandem reden, um nur drei Beispiele von Unangepassten zu nennen, die es in einer freiheitlichen Gesellschaft, die sich zur Achtung jedes einzelnen Menschen bekennt, eigentlich gar nicht geben sollte.
Es gibt sie aber. Die Gesellschaft, in der niemand an den Rand gedrängt wird, existiert nur im Paradies und gewiss nicht dort, wo das Grundprinzip der Achtung des Menschen a priori durch das des Konkurrenzkampfes der Menschen konterkariert wird. Um in diesem Kampf zu bestehen, stützen wir uns auf unsere Identität. Dabei wird aus der Ich-Identität des »wahren Selbst« unversehens die »Wir-Identität« der Gruppenzugehörigkeit. Denn so wahr und achtbar das individuelle Selbst auch sein mag, auf sich allein gestellt, ist es oft zu schwach, um Toleranz für seine Besonderheit einfordern zu können. Aus der Identität des »ich kann nicht anders«, denn »Ich bin ich. Das allein ist meine Schuld!« wird deshalb die Identität des »ich bin eine/r von uns«. In diesem Übergang von »Identität« zu »sich identifizieren mit« ruht der Keim der Intoleranz, den nicht alles überwuchern zu lassen, die größte unerfüllte Aufgabe der Aufklärung ist. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, wird sich dieser Keim nie ausmerzen lassen, aber individuelle Identität als Idee und als Forderung birgt die Möglichkeit, kollektive Identität nicht als unentrinnbares Geschick zu begreifen. Die Betonung der individuellen Identität kann man als Aufforderung verstehen, sich nicht gedankenlos einer kollektiven Identität zu überlassen.
3. Appassionato
Leidenschaftlich: Geschlecht: Duett, Terzett, Polyphon
Seit 2017 gibt es im deutschen Recht nicht mehr nur Adam und Eva. Denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat auf die Pauke gehauen:
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) schützt die geschlechtliche Identität. Es schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. 10. Oktober 2017, 1 BVR 2019/16
Deshalb suchen Unternehmen heute nicht mehr Stapelfahrer, Kranführer, Sachbearbeiter und IT-Spezialisten etc., sondern Staplerfahrer (w/m/d), Kranführer (w/m/d) und Sachbearbeiter (w/m/d) und IT-Spezialisten (w/m/d) etc. Der Berufsbezeichnung in der Stellenausschreibung eine Klammer »(w/m/d)« für »männlich, weiblich, divers« hinzuzufügen, ist eine Kleinigkeit. Aber dahinter steht ein ideologischer Wandel von großer Tragweite, der gesellschaftliche Konventionen und Institutionen, insbesondere die Familie, auf vielfältige Weise berührt.
Ebenfalls 2017 legalisierte der Deutsche Bundestag die gleichgeschlechtliche Ehe. Ihrem Ruf als liberale Vorreiter gerecht werdend, hatten die Niederlande das bereits 2000 getan. Inzwischen sind die meisten skandinavischen und westeuropäischen Länder gefolgt, zuletzt Österreich, wo die gleichgeschlechtliche Ehe seit 2019 gesetzlich erlaubt ist. In Osteuropa ist das fast durchgehend nicht der Fall und in vielen anderen Teilen der Welt auch nicht.
Der § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte, war von 1872 bis 1994 gültig. Die Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Neigungen entsprach der zweiwertigen Geschlechterlogik des christlichen Abendlands. Es gab Adam und Eva, die vom lieben Gott dazu bestimmt waren, sich zu vereinen, um für Nachkommen zu sorgen. Viel mehr gab es über die menschliche Sexualität nicht zu sagen, jedenfalls nicht laut. Konservative christliche Konfessionen betrachten Homosexualität dementsprechend als lasterhaften Abweg. Dass die Sexualmoral ebenso wie andere Moralvorstellungen dem historischen Wandel unterliegt und kulturell variabel ist, wollen sie nicht wissen und halten an ihrem Weltbild des gottgewollten Duetts von Mann und Frau als Archetyp der Paarbildung fest.
Mit ihrer Verdammung der Homosexualität stehen die Christen nicht allein. In vielen Ländern Afrikas und des Mittleren Ostens ist sie noch ausgeprägter. Der Islam, wie das Christentum eine missionarische Religion mit universalistischen Ansprüchen, wird meistens dahingehend interpretiert, dass er homosexuelle Handlungen verbietet. Sowohl in christlichen als auch in islamischen Ländern gibt es bezüglich sexuellen Verhaltens sehr unterschiedliche Einstellungen und rechtliche Bestimmungen. Was sie miteinander teilen, ist eine allgemeine Intoleranz gegenüber Normabweichungen, die sie Homosexualität als Sünde, psychischen Defekt oder Straftat einstufen lassen. Auch die dritte, besser gesagt: die erste mosaische Religion, das Judentum, lehnt Homosexualität ab, jedenfalls das orthodoxe Judentum.
Читать дальше