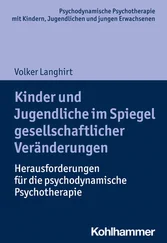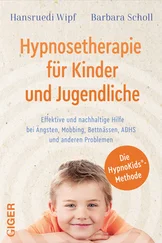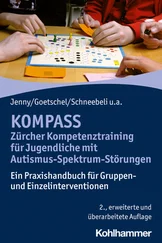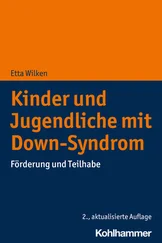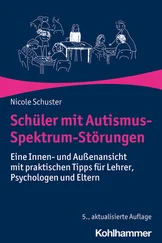Auch bei Jugendlichen am oberen Ende des Spektrums sollten Fähigkeiten wie detaillierte Computerkenntnisse, ein gutes Gedächtnis oder unbedingte Ehrlichkeit betont werden statt die Defizite in den Vordergrund zu stellen. Der Einbau von Sonderinteressen in schulische, berufliche oder soziale Ziele ist dabei oft sehr hilfreich. Daneben sollten erste Schritte des Jugendlichen zur Flexibilität, zum Umgang mit Stress, sowie angemessenem Sozialverhalten verstärkt bzw gezielt angeregt werden (Buron et al., 2012; Baker 2017, Mataya, Aspy & Shaffer, 2017; Bernard-Opitz, 2018).
Fallbeispiel 1
So fällt Andy das Addieren plötzlich leicht als er statt neutraler Mengenbilder seine geliebten Luigi-Cartoon-Abbildungen zusammenzählen darf.
Fallbeispiel 2
Svenja war schon als Kind von Buchstaben und Reihenfolgen fasziniert. Nun ist sie in ihrem ersten Praktikum begeistert, CDs und Bücher alphabetisch anordnen zu dürfen.
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) umfassen ein Kontinuum an Verhaltensauffälligkeiten, die sich in Ausprägung, Schweregrad und Prognose erheblich unterscheiden. Die Diagnose einer autistischen Störung erfolgt durch Fragebogenerhebung und Beobachtung. Wichtig für die Prognose und Therapieplanung ist das Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten und das Erstellen eines Intelligenz- und Fähigkeitsprofils. Frühkindlicher Autismus geht in vielen Fällen mit anderen Problemen einher wie Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs-, Organisations- oder Schlafstörungen. Eine medikamentöse Behandlung kann in einigen Fällen zusätzlich zu strukturierten und sensomotorischen Therapien sinnvoll sein. Statt Defizite zu betonen, sollten auch bei Betroffenen am oberen Ende des Autismus-Spektrums Fähigkeiten aufgegriffen und gezielt verstärkt werden. Einen günstigen Einfluss auf die Prognose hat auch eine positive Einstellung der Eltern und der sozialen Umwelt.
2 Welche Therapieansätze gibt es?
2.1 Gibt es »Allheilmittel«?
2.2 Was ist Strukturierte Therapie und Autismus-spezifische Verhaltenstherapie (AVT)?
2.3 Zusammenfassung
2.1 Gibt es »Allheilmittel«?
Ein halbes Jahrhundert lang wurden Kinder mit der Diagnose »Frühkindlicher Autismus« als unheilbar eingestuft. Nur etwa 5 % der Betroffenen hatten eine normale Entwicklung zu erwarten, während die Mehrheit ihr Leben in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder mit intensiver Hilfe verbringen musste. Zwar geht man auch heute noch davon aus, dass es sich bei ASS um eine schwerwiegende Beeinträchtigung handelt, aber man weiß mittlerweile, dass die Problematik behandelbar ist (Green, 1998; Wong et al., 2013).
Die Suche nach einem »Generalschlüssel« für die Probleme der betroffenen Kinder hat in der populärwissenschaftlichen Literatur zwar oft für Schlagzeilen gesorgt, Therapien mit Allheilanspruch haben jedoch systematischen Untersuchungen nicht standgehalten (Weiss, 2002).
Gibt es eine Methode für alle Probleme bei Kindern mit ASS?
 Kuschelpädagogik?
Kuschelpädagogik?
 Festhaltetherapie?
Festhaltetherapie?
 Gestützte Kommunikation?
Gestützte Kommunikation?
 Delphintherapie?
Delphintherapie?
 Auditorische Integration?
Auditorische Integration?
 Diäten, Vitamine etc.?
Diäten, Vitamine etc.?
Das trifft für die ursprüngliche Annahme Kanners (1943) zu, dass Autismus durch sog. »Kühlschrankeltern« bedingt sei, ebenso für spätere »Allheiltherapien« wie »Kuschelpädagogik«, Festhaltetherapie und Gestützte Kommunikation, Diese Ansätze gingen davon aus, dass Autismus wie ein Gefängnis ist, das auf einer pathologischen Beziehung zu den Eltern oder mangelndes Vertrauen basiert. Durch Beziehungsaufbau, Festhalten, Stützen der Hand bei der Kommunikation sowie den Glauben an intakte kognitive Fähigkeiten könnte man die Probleme abbauen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass diese Bemühungen oder auch das Schwimmen mit Delphinen, gefilterte Musik, Pränatalräume und ähnlich diffus ganzheitliche Ansätze auf einzelne Kinder positiv wirken, aber bei genauer Prüfung haben diese Ansätze oft nur kurzfristige Placeboeffekte gezeigt (Jacobson, Foxx & Mulick, 2005). Sofern Kinder profitierten, zeigte sich, dass dieses an verhaltenstherapeutischen Strategien lag statt an den angenommen psychodynamischen Prozessen. In systematischen Untersuchungen konnten obige Erklärungs- und Therapieansätze nicht bestätigt werden (Schreibman, 2005; Wong et al., 2013). Demgegenüber wird der Aufbau einer positiven Beziehung in verhaltenstherapeutischen Programmen nicht als Voraussetzung für die eigentliche Arbeit angesehen, sondern diese entsteht bereits in der ersten Therapiestunde. Aufgabe des Therapeuten ist es, durch »liebevolle Eindeutigkeit« eine verlässliche, positive Situation zu schaffen, in der der Betreffende motiviert und gefordert wird, ohne überfordert zu sein.
Als Beispiel alternativer Therapiemethoden werden im Folgenden die Auditorische Integrationstherapie und die Gestützte Kommunikation herausgegriffen. Weiss (2002) hat diese Ansätze ausführlich beschrieben und vergleichend bewertet.
So hat z. B. vor einigen Jahren die Auditorische Integrationstherapie (AIT) viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Die Entwickler dieses Ansatzes, Tomatis und Berard, beschrieben, dass regelmäßiges Hören von Musik, bei der bestimmte Frequenzen herausgefiltert sind, zu einer Verbesserung auditiver Wahrnehmung führt (Berard, 1993). Systematische Untersuchungen ergaben jedoch, dass zwischen Kindern, die gefilterte Musik hörten, kein Unterschied gegenüber solchen bestand, die ungefilterter Musik ausgesetzt waren (Bettison, 1996). Auch zeigte sich keine Veränderung in den elektrophysiologischen Werten von Kindern, die diese Therapie im Vergleich zu Kindern ohne eine solche Exposition erhielten (Rimland & Edelson, 1995; Gravel, 1994; Schreibman, 2005).
Eine ebenfalls in Fachkreisen kontrovers diskutierte Therapiemethode ist die Gestützte Kommunikation (Englisch »Facilitated Communication« Abk.: FC). FC machte besonders in den 1990er-Jahren durch verblüffende Berichte von verdeckter Intelligenz bei selbst als stark geistigbehindert geltenden Menschen mit ASS auf sich aufmerksam (Biklen, 1993; Nagy, 1993; CMHO, 2002). Bei dieser Methode berührt ein sog. »Facilitator« Hand, Arm oder Schulter des Kindes/Jugendlichen während es/er auf Bilder, Buchstaben oder Wörter zeigt oder diese schreibt. In kontrollierten Untersuchungen konnte die Annahme eigenständiger Kommunikation allerdings nicht bestätigt werden, d. h., dass die »Facilitatoren« und nicht die Klienten – wenn auch unbewusst – die jeweilige Kommunikation beeinflusst haben (zusammenfassend siehe Shane, 1994; Weiss, 2002; Schreibman, 2005). Um Fehleinschätzungen zu vermeiden, werden verschiedene Voraussetzungen, Kontrollen und Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von FC vorgeschlagen (Biermann, 1999; Klicpera et al., 2001).
Nahrungsmittelunverträglichkeit, Umweltgifte und gastro-intestinale (Abk.: GI) Probleme sind in den letzten Jahren verstärkt im Zusammenhang mit Autismus diskutiert worden. Auch ein möglicher Einfluss auf die Entstehung von Autismus durch die MMR (Masern, Mumps und Rubella) Impfung hat zu einer Verunsicherung von Eltern und erheblichen Kontroversen geführt (Wakefiel, 2002). Da Nachfolgeuntersuchungen keinen Zusammenhang zwischen der Regression der Kinder und Impfungen fanden, erscheint die Impfschaden-Hypothese unwahrscheinlich (Hansen & Ozonoff, 2003). Andererseits gelten nicht-genetische Umwelteinflüsse, wie Virusinfektionen während der Schwangerschaft oder nach der Geburt sowie die Zusammensetzung der Darmflora als sehr wahrscheinliche Faktoren in der Ätiologie des Autismus (Bernard, 2017).
Читать дальше
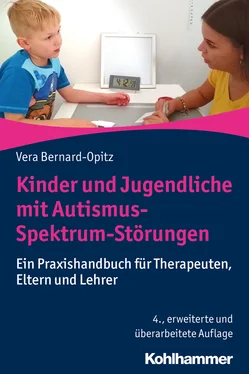
 Kuschelpädagogik?
Kuschelpädagogik?