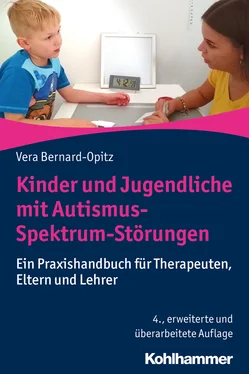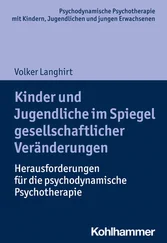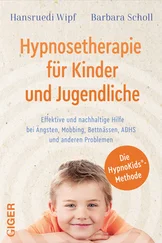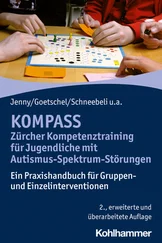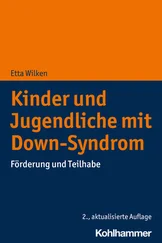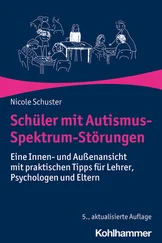Skalen zur Erfassung der Selbständigkeit wie die Vineland Social Maturity Scale (Sparrow et al., 1984) und ihre deutschsprachigen Versionen (Bondy et al., 1977; Duhm & Huss, 2002) sollten ebenfalls herangezogen werden. Sie sind speziell bei Kindern mit Asperger-Syndrom oder Kindern mit frühkindlichem Autismus und guter Intelligenz sinnvoll, um etwaige Defizite in der Selbständigkeit realistisch einzuschätzen.
Eine ausführliche Darstellung der neuropsychologischen Testverfahren übersteigt den Rahmen dieses Buchs. Um Bereiche der emotionalen Intelligenz, exekutiver Funktionen und der zentralen Kohärenz abzuklären, wird auf die ausgezeichnete Zusammenfassung von Bölte & Bormann-Kischkel (2009) hingewiesen.
Oft sind Eltern und Erzieher zunächst jedoch an einem Überblick über den Stand der Entwicklung des Kindes im Vergleich zu allgemeinen Altersnormen interessiert. Hier bietet das sensomotorische Entwicklungsgitter (Kiphard, 2006; Sinnhuber, 2011) einen ersten Einblick in Entwicklungsnormen für Sprachausdruck und Sprachverständnis, Fein- und Grobmotorik sowie optische Wahrnehmung an. Da Betroffene mit Asperger oft motorisch ungeschickt sind, sollte auch die Motorik mit in die Befunderhebung einbezogen werden (Remschmid, 2000).
Neben obigen norm-basierten Testverfahren und Screening-Methoden können kriterienbasierte Verfahren eingesetzt werden. Hierbei geht es nicht um den Vergleich der Leistung des Getesteten mit der seiner Altersgenossen, sondern um das Erfassen von zentralen Fähigkeiten, die für die Entwicklung bedeutsam sind. Das kann mit einem Fahrtest verglichen werden, bei dem man auch davon ausgeht, dass der Getestete ausreichendes Wissen hat, um am Straßenverkehr teilzunehmen.
Curricula, wie das Carolina Curriculum (Johnson-Martin et al., 2013a, b), das VB-MAAP (Sundberg, 2008) oder auch das hier vorliegende STeP-Curriculum, können als Kompromiss zwischen norm- und kriterienbasierten Methoden angesehen werden. Sie sind ein Versuch, Förderziele zu definieren, die an Entwicklungsstufen angelehnt sind, aber gleichzeitig bedeutsame Meilensteine der normalen Entwicklung darstellen.
1.2.3 Welche zusätzlichen Probleme bestehen?
Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die eine biologische Basis hat (Ozonoff, Rogers & Hendren, 2003, Bernard, 2017). Die Mehrzahl der Kinder mit ASS hat unspezifische hirnorganische Auffälligkeiten (Bölte & Poustka, 2002a). Selbst wenn keine spezifischen organischen Auffälligkeiten gefunden werden, besteht die Gefahr von epileptischen Anfällen. So berichtete Gillberg (1990), dass bei einem von sechs Kindern in der Pubertät Anfälle auftreten. Nachfolgeuntersuchungen haben allerdings gezeigt, dass Kinder mit leichten Intelligenzproblemen und ASS ein sehr viel geringeres Anfallsrisiko haben (s. Zusammenfassung, Freitag, 2009). Der Schweregrad eines Anfallsleidens und seine medikamentöse Kontrolle sind in jedem Fall für die Prognose wichtig.
Zusatzprobleme wie Ängste, Depressionen, Schlafprobleme, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (ADHS), sensorische Störungen, Tourette-Syndrom und Zwänge treten bei etwa 70 % der Betroffenen auf (Poustka, 2012). Hierbei gehören soziale Phobien, Hyperaktivität und oppositionelles Verhalten zu den häufigsten Zusatzproblemen (CMHO, 2002; Leyfer & Folstein, 2006). Sie sollten in jedem Fall in den Erstgesprächen abgeklärt werden und bei der Therapieplanung berücksichtigt werden.
Neben verhaltenstherapeutischen (Döpfner et al., 2002; Lauth & Schlottke, 2002; Petermann, 2002) und kognitiven Maßnahmen (Baker, 2017) kann manchen Kindern durch Medikamente geholfen werden (Bölte & Poustka, 2002b; Portes, Hagerman & Hendren, 2003; Poustka, 2012). So hat bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit aggressivem, ängstlichem und zwanghaftem Verhalten Risperidon nachweislich gute Wirkungen gezeigt (McDougle et al., 1998, Canitano & Scandurra, 2008).
Auch Schlafprobleme können sowohl verhaltenstherapeutisch als auch medikamentös angegangen werden (Durand, 2002). Als hilfreiches einschlafförderndes Mittel für Kinder mit ASS ist seit einiger Zeit Melatonin beschrieben worden (Poustka, 2012). Auch im Bereich der bei ADS üblichen Behandlung mit Stimulantien wie Ritalin oder Cylert sind neue Medikamente mit weniger Nebenwirkungen und längerer Wirkungsdauer wie Adderall, Concerta, Stratera oder Atomexin entwickelt worden. Ein ausgezeichneter Überblick über Psychopharmaka bei ASS findet sich bei Poustka (2012).
Eine Kombination von medikamentöser und verhaltenstherapeutischer Behandlung ist auch bei ADHS-Symptomen autistischer Kinder sinnvoll. Oft kann hierdurch eine Verbesserung von Aufmerksamkeit und Lernausfällen beobachtet werden (Born & Oehler, 2004; Simchen, 2004).
Gleiches gilt auch für Angst- und depressive Störungen, bei denen neben pharmakologischer Therapie auch kognitive Verhaltenstherapie erfolgreich eingesetzt worden ist (Scarpa & Reyes, 2011; Dunn-Baron et al., 2012; Baker, 2017).
Bei etwa der Hälfte der Kinder mit ASS liegen Hör- oder Sehstörungen sowie sensomotorische Abweichungen vor (Ayers, 1979; Frith & Baron-Cohen, 1987; Myles, Dunn & Orr, 2000). Vestibuläre Störungen liegen in den meisten Fällen bei den Kindern zugrunde, die sich ausdauernd drehen, springen oder klettern, aber auch bei denjenigen, die Angst bei Lageveränderungen oder Probleme mit der Balance haben. Manche Kinder wehren es eindeutig ab, in die Luft geworfen zu werden, zu schaukeln oder sich zu drehen.
Obige Zusatzprobleme sollten abgeklärt und durch Teamarbeit mit Sprach-, Beschäftigungs- und Mototherapeuten mit sensomotorischer Zusatzausbildung angegangen werden.
Eine enge Absprache mit Eltern, Ärzten, Psychologen, Lehrern und Erziehern ist dabei sinnvoll. Programme zu auditiven Wahrnehmungsstörungen (Nickisch, Heber & Burger-Gärtner, 2001) sensomotorische Programme (Ayres, 1979; Smith Myles et al., 2000), verhaltenstherapeutische und selbst kognitive Programme können von den Eltern unterstützend durchgeführt werden.
Berichte von Betroffenen mit ASS verdeutlichen, wie eine veränderte Wahrnehmungswelt zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann (Grandin & Scariano, 1986; White & White, 1987). Selbst ein einfacher Händedruck kann von dem normalen Gegenüber als unangenehm schmerzhaft erlebt werden, wenn der betroffene Mensch mit ASS keine angemessene Rückmeldung über seine Druckstärke hat.
Verhaltenstherapeutische, sensomotorische und/oder medikamentöse Behandlung ebnet in vielen Fällen den Weg zu einem normalen Lernen. Oft ist es optimal, diese Ansätze beim einzelnen Kind zu integrieren, was aber den Rahmen dieses Trainingsmanuals sprengen würde. Es wird daher im Wesentlichen auf den verhaltenstherapeutischen Ansatz hingewiesen und bezüglich medizinischer, sensomotorischer und kognitiver Ansätze auf entsprechende Spezialliteratur verwiesen (Gillberg, 1998; Smith Myles et al., 2002; Poustka, 2012; Attwood, 2004; Bernard-Opitz, 2014a).
1.3 Welche frühen Anzeichen für ASS gibt es?
Während normale Babys bereits im Alter von drei Monaten Blickkontakt haben und ihren Interaktionspartner anlächeln, fehlen diese ersten Kommunikationszeichen meist bei Kleinkindern mit autistischem Verhalten. Bereits vor Ende des ersten Lebensjahres können bei einigen Kindern besorgniserregende Merkmale beobachtet werden wie das Ausbleiben der Blickverfolgung einer Person, fehlende Blicksuche bei überraschenden oder beängstigenden Situationen, Nicht-Beachten, dass jemand auf etwas zeigt, und mangelnde eigene Gesten. Eine der ersten Auffälligkeiten bei Kleinkindern mit Autismus ist, dass sie keine Zeigegeste haben und speziell nicht zeigen, um auf etwas aufmerksam zu machen (sog. protodeklaratives Zeigen). Manche Kinder können zwar zeigen, aber benutzen die Zeigegeste nur, wenn sie etwas wollen (sog. protoimperatives Zeigen) (Mundy, Sigman & Kasari, 1994).
Читать дальше