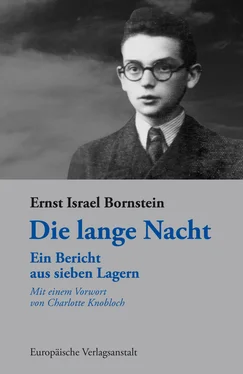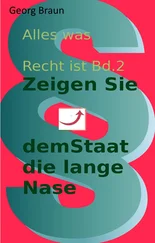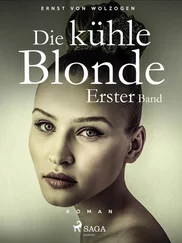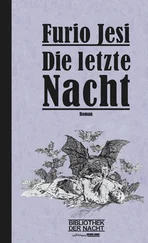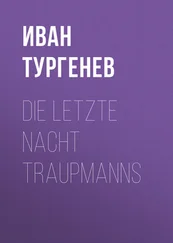Auf Befehl der Gestapo bildete sich ein »Judenrat«, dem aufgetragen wurde, Kontributionsgelder einzutreiben und den deutschen Behörden täglich einige hundert Männer für verschiedene Arbeiten zur Verfügung stellen. So musste auch ich mich zunächst jeden zweiten Tag zum Arbeitseinsatz melden. Wir wurden damit beschäftigt, die Straßen zu reinigen, die Polizeireviere sauber zu machen, Pferdeställe in Ordnung zu halten und verschiedene Transportarbeiten auszuführen. Oft genügte die Zahl der Arbeiter nicht, die dem Judenrat zur Verfügung stand, dann holte die deutsche Polizei gewaltsam jüdische Männer aus ihren Wohnungen.
Anfang 1940 hatte man die Juden aus dem deutschen Grenzgebiet um Teschen und Kattowitz ausgesiedelt und in unseren Kreis eingewiesen. Auch in unsere Stadt kamen einige hundert Familien. Die Vertriebenen hatten aus ihren Wohnungen nur einen Koffer Wäsche mitnehmen dürfen und waren völlig mittellos, da man ihnen alles Bargeld abgenommen hatte. Das heillose Elend der Vertreibung stand uns nun erstmals vor Augen. Auch in unserem Haus musste man für einige vertriebene Familien Platz machen, sie mit dem notwendigsten Hausrat versorgen und ihnen mit Geld aushelfen, damit sie die ohnehin kärglichen Lebensmittelrationen auf Karten kaufen konnten. Alle Bedürftigen wurden schließlich von der jüdischen Wohlfahrt betreut. Sie richtete Wohlfahrtsküchen ein, in denen die Mittellosen umsonst essen konnten, und gab kostenlos Lebensmittel aus. Unter den Familien, die in unser Haus aufgenommen wurden, war auch eine Familie mit vielen Kindern aus der deutsch-polnischen Grenzstadt Tarnowitz. Der Vater der Familie, Herr Hadda, war ein stolzer deutscher Nationalist, im Ersten Weltkrieg war er Offizier gewesen, hatte dann die oberschlesischen Kämpfe mitgemacht. Für seine Heldentaten im Kampf um Annaberg hatte er eine hohe Auszeichnung erhalten, und stolz erzählte er, dass auch auf seine Initiative hin das oberschlesische Gebiet Annaberg verteidigt und für das Deutsche Reich erhalten wurde. Täglich predigte er uns, dass es sicher ein Irrtum sei, dass gegenwärtig die deutschen Juden in alle Schikanen und Verfolgungen einbezogen wurden. »Es sind nur die Ostjuden gemeint«, sagte er. Und oft gebrauchte er sogar den Ausdruck »der Führer«, ein Wort, das er mit Stolz und Respekt aussprach. Er meinte, es wären nur kriegsbedingte Vorsichtsmaßnahmen, dass man die deutschen Juden verfolge. Sobald der Krieg vorbei sei, würde man ihnen ihre Rechte wiedergeben. Doch auch ihm, dem begeisterten Patrioten, sollten seine Kriegsauszeichnungen, die er für seinen tapferen Kampf ums deutsche Vaterland erhalten hatte, wenig nützen. 1943 wurde er zusammen mit seiner Familie nach Auschwitz gebracht und mit anderen jüdischen Einwohnern von Zawiercie vergast und verbrannt.
Der Frühling 1940 zeigte seine ersten blutigen Spuren. In einer Nacht verhaftete man zwölf Personen, meistens junge Menschen, die sofort verschwanden, ohne dass man je wieder von ihnen hörte. Es hieß, dass die deutschen Behörden aus Sicherheitsgründen alte Kommunisten in ihrem Gewahrsam haben wollten. Unter den Verhafteten waren aber nur wenige Kommunisten. Auch unser Nachbar Yehuda Grünkraut wurde in dieser Nacht von der Gestapo geweckt. Er musste sich eilig anziehen und mitkommen. Grünkraut war ein aktives Mitglied der zionistischen Bewegung »Bejtar«, einer rechtsgerichteten nationalen Partei. Die Verhaftung Grünkrauts war auf eine Denunzierung zurückzuführen. Überhaupt blühte das Denunziantentum. Die Zuträger waren meist Polen, die sich nun als Volksdeutsche bei der Gestapo meldeten und sich als emsige Helfer verdingten. Um der Gestapo ihren Eifer zu beweisen, stellten sie willkürlich Namenslisten zusammen. Auf Grund dieser Listen wurden oft Menschen verhaftet, an denen die Gestapo gar nicht interessiert war. Nach einigen Wochen erhielten die Eltern Grünkrauts ein Kleiderpaket und die Nachricht, dass ihr Sohn an Herzschwäche verstorben sei. In dieser Zeit wurde ich einmal das Opfer einer Namensverwechslung. Wie schon erwähnt, musste die jüdische Gemeinde oder, wie sie sich jetzt nannte, der »Judenrat«, eine ziemlich hohe Kontributionssumme an die deutsche Verwaltung abliefern. Da die Summe nicht rechtzeitig beschafft werden konnte, verhaftete die Gestapo dreißig Juden, die man vornehmlich aus den Reihen der wohlhabenden älteren Bürger unserer Stadt wählte. Auch der Name Bornstein stand auf ihrer Liste. So geschah es, dass eines Tages zwei Gestapobeamte bei uns erschienen und mich mitnahmen, da ich zufällig allein zu Hause war. Zusammen mit einigen anderen Leidensgefährten wurde ich auf einem Lastwagen nach Sosnowitz gebracht, wo die SS ein Ausbildungslager hatte. Jungen SS-Leuten wurde dort der »richtige« Umgang mit Untergebenen und Gefangenen beigebracht. Zum ersten Mal in meinem Leben verbrachte ich Tag und Nacht in der Nähe der SS. Wie sich herausstellte, sollten wir als Versuchstrupp für die SS dienen. Die Nächte verbrachten wir in einem zugigen Schuppen, in voller Bekleidung auf harten Holzpritschen ausgestreckt. Frühmorgens weckte uns ein durchdringendes Pfeifsignal. Wir bekamen eine Tasse schwarzen Kaffee und ein Stück Brot, dann wurden wir auf den Exerzierplatz getrieben. Nun begannen stundenlange strapazierende Übungen, denen viele von uns nicht gewachsen waren. Den Erschöpften wurde mit Schlägen wieder auf die Beine geholfen.
So vergingen einige Tage in ständiger Hetze. Später schickte man uns ohne weitere Erklärung wieder nach Hause. In unserer Heimatstadt fanden wir schlimme Veränderungen vor. Wir stießen unvermittelt auf so ungewohnte Beschränkungen und Einengungen, dass die eben erduldeten Demütigungen daneben geringfügig erschienen. Hatte man schon bisher jüdische Familien, die in der Nähe von öffentlichen Ämtern und Behörden lebten, zur Umsiedlung in andere Straßen und Stadtteile gezwungen, so waren diese vereinzelten Maßnahmen nun zu einer Großaktion ausgeweitet worden, deren Ziel auch dem Wohlmeinendsten nicht verborgen bleiben konnte: Man baute planmäßig ein Getto auf, in dem wir bald wie in einem Käfig lebten. Da der Zustrom der jüdischen Bevölkerung von den umliegenden Stadtteilen anhielt, nahm die Wohnraumnot ständig zu – nicht zu sprechen von der finanziellen und wirtschaftlichen Notlage, da ja besonders die geistig Schaffenden durch die behördlichen Zwangsmaßnahmen aus ihren Stellungen verdrängt worden waren und keine Möglichkeit hatten, eine neue Existenz aufzubauen.
Wir erhofften uns nichts Gutes von den kommenden Tagen und versuchten, wenigstens einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. So besorgten wir uns bereits im Sommer schwere Winterschuhe und Winterkleidung, da sich hartnäckig das Gerücht hielt, dass für die Juden Arbeitslager errichtet würden und unser aller Weg dorthin führen musste. Aber noch fanden einige Polen Mittel und Wege, in unser Getto zu kommen und uns zusätzlich mit verschiedenen Lebensmitteln und anderen Dingen zu versorgen, die es bei uns schon nicht mehr gab. Besonders Textilien standen hoch im Kurs. Langsam schwand unser Hab und Gut bei diesen Tauschaktionen dahin.
Die Mühen und Gefahren, die wir auf uns nehmen mussten, um das tägliche Leben zu fristen, lenkten uns zunächst von allen Zukunftsplänen ab. Der Spuk musste ja einmal ein Ende nehmen. Im Übrigen hatten wir längst keine Möglichkeit mehr, aktiv über unser Schicksal zu bestimmen. Jeder wusste, dass eine Flucht aus dieser Gefangenschaft von vorneherein zum Scheitern verurteilt war.
Bald darauf wurden die Schikanen weiter verschärft. Eine neue Verordnung zwang alle Juden, ihre Geschäfte Treuhändern zu übergeben. In unserem Gebiet wurden einige hundert Ruthenen- Deutsche angesiedelt, denen die jüdischen Geschäfte übereignet wurden. Auch mussten einige hundert jüdische Familien ihre Wohnungen räumen, um für die Volksdeutschen Platz zu schaffen, so dass das Getto immer kleiner und der verbliebene Raum immer überfüllter wurde, denn die Obdachlosen mussten wiederum bei anderen jüdischen Familien Unterschlupf suchen. Im Spätsommer 1940 erhielt der Judenrat den Befehl, einige hundert Männer zum Arbeitseinsatz zur Verfügung zu stellen. Sie sollten beim Bau der Autobahn eingesetzt werden. Als ich erfuhr, dass auch mein Name auf der Verschickungsliste stand, flüchtete ich und versteckte mich zwei Wochen lang in der benachbarten Stadt. Erst als der Transport für dieses Zwangsarbeitslager abgegangen war, kehrte ich zurück. Inzwischen waren einige meiner Kameraden verschleppt worden. Der Kummer ihrer Angehörigen war so groß, dass ich es verständlicherweise nicht wagen konnte, ihnen gegenüberzutreten, da ich dem Schicksal der Verschleppten noch einmal entgangen war.
Читать дальше