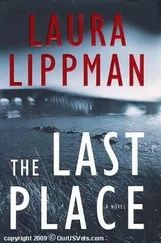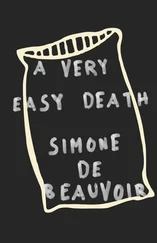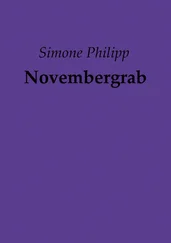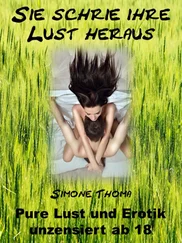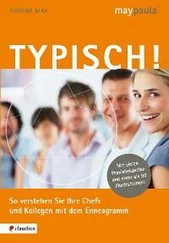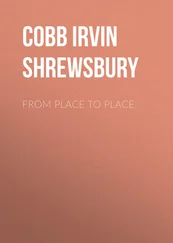Denn auf die Sonnentage folgten die Regentage. Düstere, schwere Tage. Meine Mutter war wie ausgewechselt und schien mich kaum wahrzunehmen. Oft stand sie an solchen Tagen gar nicht erst aus dem Bett auf. Die dunklen Samtvorhänge, die schon meine Urgroßmutter vor ihren Fenstern hängen und die sie an meine Mutter vererbt hatte, wie auch das große alte Haus, in dem wir lebten, blieben zugezogen und ließen alles im Dämmerlicht. Mama schlief dann stundenlang, und wenn sie irgendwann hinunter in die Küche kam, wo ich mich bemüht hatte, ein besonders leckeres Essen zu kochen, damit sie bald wieder gesund werden würde, sah man an ihren roten Augen, dass sie geweint hatte.
Dann saß sie erschöpft auf dem harten Küchenstuhl und sah gedankenverloren aus dem Fenster. Das Essen rührte sie nicht an und statt mir auf mein Geplapper zu antworten, sah sie durch mich hindurch und seufzte. Irgendwann schleppte sie sich dann immer nach nebenan auf unser gemütliches braunes Cordsofa, das so breit war, dass bequem drei Leute gleichzeitig darauf liegen konnten, rollte sich zusammen und schlief ein. Damit ihr nicht kalt wurde, holte ich meistens rasch meine alte Babykuscheldecke, die noch immer in meinem Bett lag, auch wenn ich eigentlich schon viel zu groß dafür war, und deckte sie damit zu. Dann setzte ich mich auf den Boden vor die Couch, um auf Mama aufzupassen. Sie sollte, wenn sie aufwachte, sehen, dass ich da war und sie lieb hatte.
Ich verstand damals nicht, was mit meiner Mutter los war. Ich zerbrach mir den Kopf darüber, was ich wohl getan hatte, dass Mama so traurig machte. Damit sie wieder lieb und fröhlich war, versuchte ich, schon im Voraus zu erahnen, womit ich ihr eine Freude machen konnte.
Manchmal freute Mama sich, wenn ich ihr Blumen brachte, die ich auf der Wiese neben unserem Haus gepflückt hatte. Im Mai stand oft der ganze Küchentresen voller kleiner Vasen mit Löwenzahn, den wir wegen seiner gelben Farbe Butterblumen nannten. Dann konnte es sein, dass meine Mutter mich drückte und lachte und mich: „Jella, mein Sonnenkind“, nannte. Und die Vorhänge im Schlafzimmer waren offen.
Manchmal strich sie mir geistesabwesend über den Kopf, lächelte zerstreut und sah an mir vorbei. Und manchmal stellte ich die Blumen vor Mamas Schlafzimmertür, und sie standen am nächsten Morgen immer noch dort. Bis Frau Hansen, unsere Putzfrau, die zweimal in der Woche die Böden wischte, staubsaugte und aufräumt, die Blumen mitnahm, weil sie die Köpfe hängen ließen.
Die Regentage verschwanden davon nicht. Manchmal klappte es, dass Mama einen Sonnentag hatte, wenn ich es am Tag zuvor auf dem Rückweg von der Schule geschafft hatte, auf keine der Ritzen zwischen den Pflastersteinen zu treten. Das ging bei den großen Steinen auf dem Pausenhof und direkt hinter der Schule noch ganz leicht. Mein Weg führte aber auch durch eine kleine Gasse mitten im Ort, vorbei an der einzigen Bäckerei, aus der es immer so lecker roch, wenn im Sommer die Tür aufstand, und hier passierte es mir immer wieder, dass ich doch auf eine der Ritzen zwischen den kleinen Pflastersteinen trat.
Manchmal bemerkte ich es auch gar nicht, aber wenn der nächste Tag ein Regentag war, wusste ich, dass ich nicht gut genug aufgepasst hatte, und war wütend auf mich. Ich flüsterte dann Mama durch die geschlossene Schlafzimmertür zu, dass ich am nächsten Tag noch viel besser aufpassen würde. Und dass dann alles wieder gut sein würde.
Als ich in der zweiten Klasse war, erzählte meine Lehrerin Frau Thomas von Religionen aus fernen Ländern und davon, dass manche Menschen dort ihren Göttern Opfer brachten, damit die Götter die Wünsche der Menschen erfüllten. Auf dem ganzen Nachhauseweg arbeitete es in mir. Das musste ich unbedingt versuchen! Jetzt wusste ich, was Mama helfen würde!
Als ich zu Hause war, rannte ich sofort in mein Zimmer. Ich wusste schon ganz genau, dass nur ein bestimmter, einzigartiger Gegenstand ein Opfer abgeben würde, das mächtig genug war, um meinen Wunsch zu erfüllen. Mit heiligem Ernst nahm ich Bruno, den Bären mit der blauen Latzhose, der seit dem Tag meiner Geburt in jeder Nacht an meiner Seite gelegen und über meinen Schlaf gewacht hatte, und lief mit ihm nach draußen.
Frau Thomas hatte uns gesagt, dass manche Opfergaben von den Menschen verbrannt, manche auch in einen Fluss geworfen wurden. Da ich kein Feuer machen konnte, lief ich mit Bruno zu dem kleinen Fluss, der sich in sanften Rundungen durch die Wiesen am Rande unseres kleinen Städtchens schlängelte. Vollkommen sicher, das Richtige zu tun, warf ich Bruno, ohne zu zögern, in das Wasser. Dann schloss ich die Augen und wünschte mir ganz fest, dass es von nun an nur noch Sonnentage für Mama geben solle. Ich weiß noch, dass es ein warmer Tag war und ich in der Nähe das Tuckern eines vorbeifahrenden Treckers hörte. Und ich war froh, denn nun würde endlich immer alles gut sein.
Auf dem Heimweg kamen mir erste Zweifel. Immerhin hatte das mit den Butterblumen und den Ritzen zwischen den Steinen auch nicht stets die gewünschte Wirkung erzielt. Was, wenn ich Bruno vielleicht nicht richtig in das Wasser geworfen und das Opfer gar nicht funktionierte, weil ich irgendwas falsch gemacht hatte? Und hatte Frau Thomas nicht auch gesagt, dass diese Opfer oft zu bestimmten Zeitpunkten stattfanden, zum Beispiel, wenn Vollmond war oder an bestimmten Feiertagen? Was, wenn ich es mal wieder nicht RICHTIG gemacht hatte? Dann wäre Bruno ganz UMSONST im Wasser untergegangen!
Dieser Gedanke traf mich wie ein Blitz. Über Brunos Schicksal hatte ich mir vorher nicht die geringsten Gedanken gemacht. Ich war völlig beseelt gewesen von dem Wunsch und meiner Zuversicht, nun wirklich alles zum Guten wenden zu können. Nun aber wurden mir die Konsequenzen meines Handelns mit voller Wucht bewusst. Ich hatte meinen geliebten Bruno, meinen ältesten und treuesten Gefährten und Tröster, ohne den ich noch nie eine Nacht geschlafen hatte, IN DEN FLUSS GEWORFEN! Und wahrscheinlich hatte ich es auch noch FALSCH gemacht, sodass Mama noch nicht mal FROH dadurch wurde!
Ich brach in Tränen aus und rannte wie verrückt zurück zu der Stelle, an der ich Bruno ins Wasser geworfen hatte. Natürlich hatte die Strömung ihn längst fortgespült. Voller Verzweiflung hastete ich am Flussufer entlang und hielt nach etwas Braunem, Pelzigem mit hellblauer Latzhose Ausschau. Ich rannte und rannte, stolperte, fiel hin und – sah beim Aufstehen einen braunen Zipfel, der an einem Ast hängend am Ufer über den Grasrand lugte. Schnell robbte ich an den Rand der niedrigen Böschung und griff nach dem Zipfel. Um ihn zu erreichen, musste ich mich ganz lang machen, aber ich schaffte es. Erleichtert griff ich nach dem durchnässten Bären und drückte ihn an mich. Doch plötzlich verlor ich an dem rutschigen Ufer den Halt, strauchelte, balancierte kurz auf der Stelle und kippte dann rücklings in das kalte Wasser.
Der Fluss war nicht tief, es war Sommer und ich konnte schwimmen, aber vor lauter Überraschung und Schreck brüllte ich wie am Spieß, ruderte wild mit den Armen und versuchte panisch, mit den Füßen wieder Halt zu finden.
Nach wahrscheinlich sehr kurzer Zeit, die mir aber unendlich lang vorkam, packten mich zwei Hände fest an den Armen und zogen mich ans Ufer, wo ich heulend und erschöpft liegen blieb.
Es war der Bauer, dessen Trecker ich gehört hatte, als ich mir noch so sicher gewesen war, das Richtige zu tun. Er hatte auf seinem Feld nach dem Rechten sehen wollen und sagte meinem Vater später, dass ihm bei meinen Schreien fast das Blut in den Adern gefroren sei.
Noch Jahre später hatte ich wegen dieser Redewendung Angst im Winter, dass mir tatsächlich das Blut in den Adern gefrieren könnte und ich dann sterben würde.
Der Bauer fuhr mich auf seinem Trecker nach Hause und schimpfte den ganzen Weg lang, wie dumm und unvorsichtig ich gewesen war, so dicht am Ufer zu spielen. Drei Jahre zuvor war ein kleiner Junge in den Fluss gefallen und ertrunken. Er hatte im Garten gespielt und war, als die Mutter kurz hineingegangen war, um nach dem Essen zu schauen, das auf dem Herd stand, wohl zum Fluss gelaufen. Nachdem die Mutter das Verschwinden bemerkt hatte, wurde eine große Suchaktion gestartet, aber seine Leiche war erst am nächsten Morgen, kilometerweit flussabwärts, entdeckt worden.
Читать дальше