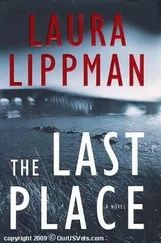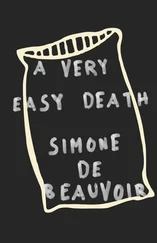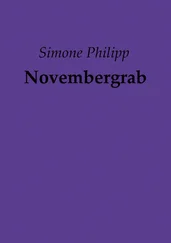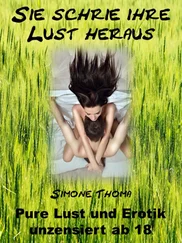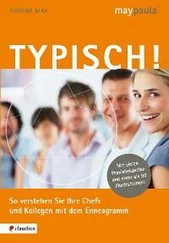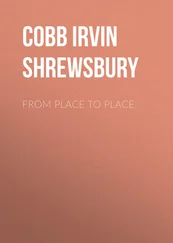Zu einer dieser Gruppen gehörte Ben, den ich schon lange heimlich gut fand. Er war 17 und kein Angeber-Typ wie manche seiner Freunde. Einmal konnte ich ihn dabei beobachtet, wie er einem Jungen aus der 7., der auf dem Schulhof von drei anderen in eine Ecke gedrängt wurde, geholfen hat. Das war typisch für ihn, deswegen mochte ich ihn auch so gerne. Deswegen ... und weil er mit seinen wuscheligen blonden Haaren und den blauen Augen auch ziemlich gut aussah. Er kümmerte sich immer um alles. Im letzten Jahr hatte er einen Artikel über Flüchtlinge geschrieben, die an unsere Schule gingen, und sogar irgendeinen Nachwuchsjournalistenpreis dafür bekommen. Trotzdem war er nicht eingebildet, sondern richtig nett und meistens gut drauf. Leider bemerkten das außer mir noch viele andere. Ben war stets von einer Gruppe von Freunden, Mädchen, die kichernd um seine Aufmerksamkeit buhlten, und einigen Mitläufern, die sich im Glanz der angesagten Clique sonnen wollten, umringt.
Zu ihnen gehörte auch Svea, die Tochter des größten Autohändlers im Ort. Sie war groß, hatte lange, in Wellen herabfallende schwarze Haare, die ihr fast bis auf die Hüften fielen, und ärgerlicherweise auch noch Grübchen in den Wangen beim Lächeln. Alle Jungs fanden sie toll, aber sie stand auf Ben. Das wusste jeder. Auch sie war schon 17 und hatte vorzeitig den Führerschein gemacht. Eigentlich durfte sie nur in Begleitung Erwachsener Auto fahren, aber ihr Vater erlaubte ihr, auf dem riesigen Gelände hinter seiner Firma mit ihrem Auto allein oder mit Freunden herumzufahren. Zu diesen Freunden gehörte auch Ben. Alle redeten darüber, wann die beiden zusammenkommen würden. Die meisten tippten auf die große Party, die Sveas Vater traditionell am 30. April zum Maitanz bei uns im Ort schmiss. Sein Autohaus sponsorte die Getränke und Sveas Bruder, der schon 22 war und studierte, spielte den DJ.
Manchmal stellte ich mir vor, dass ich auch auf dieser Party sein würde. Ben würde erkennen, dass Svea nur eine hübsche Hülle war. Er würde mich zum ersten Mal bemerken. Und wir würden zusammen tanzen … So etwas hatte ich mir schon viele Male ausgemalt. Natürlich würde mich ein Junge wie Ben in der Wirklichkeit niemals bemerken.
Ich war unauffällig. Das hatte ich jahrelang trainiert. Im Unauffälligsein war ich besonders gut. Schon immer war ich schüchtern gewesen. Es war mir ein Graus, im Mittelpunkt zu stehen. Immer war ich ein bisschen ungelenk gewesen und nicht so wie die anderen hübschen Mädchen mit ihren langen Haaren. Meine waren wellig, in einer undefinierbaren Mischung aus dunkelblond und braun, leider auch ziemlich fein und fielen nie glatt und hübsch über die Schultern. Stattdessen lagen sie meistens so, wie es ihnen passte. Mittlerweile trug ich sie halblang, was den Vorteil hatte, dass sie mir wie ein Vorhang ins Gesicht fielen und ich mich hinter ihnen unsichtbar machen konnte.
Das machte meinen Dad, wenn er denn mal zu Hause war, immer wahnsinnig. Er blickte manchmal von seinem Laptop auf, an dem noch schnell die neusten Geschäftsberichte und die aktuellen Zahlen verglichen werden mussten, und sah mich an, als hätte er mich nie vorher bemerkt. Ohnehin schien er immer erstaunt, bei seinen seltenen Aufenthalten zu Hause auf mich zu treffen. Oft hatte ich das Gefühl, er vergaß zwischendurch auf seinen Geschäftsreisen und Meetings immer wieder, dass er ein Kind hatte – mich.
Was er dann sah, schien ihm oft zu missfallen. Er fragte mich, warum ich meine Haare nicht ordentlich trug, und verstand nicht, weshalb ich wieder nicht zum Training in den elitären Hockey-Klub, den er für mich ausgesucht hatte, gegangen war. Dabei wusste jeder, der mich kannte, dass ich ein hoffnungsloser Fall beim Sport war. Ich kriegte einfach die erforderliche Koordination der Bewegungen, gepaart mit Schnelligkeit und Mut beim Spiel, nicht hin.
Einmal hatte ich bei einem Spiel, zu dem mich mein Vater voller Begeisterung geschleppt hatte, gesehen, wie Emily, einem Mädchen aus der Parallelklasse, von einem Mädchen der gegnerischen Mannschaft so unglücklich mit deren Schläger im Gesicht getroffen wurde, dass ihr ein Schneidezahn ausgeschlagen wurde. Alles war voller Blut. Und mir wurde schlecht. Mein Vater bemerkte das gar nicht, sondern lobte Emily anerkennend dafür, dass sie noch ohne Zahn und mit blutverschmiertem Gesicht weiterspielen wollte. Bis ich ihm auf seine teuren, handgenähten Lederschuhe kotzte. Er sprach den ganzen Nachhauseweg kein Wort mit mir. Für mich war klar, dass mir bei meinem Glück nicht nur ein, sondern vermutlich alle Zähne ausgeschlagen werden würden, und so weigerte ich mich von da an, auch nur ein Spiel anzuschauen.
Nach zahllosen gescheiterten Versuchen, mich zu einem Tennis-, Volleyball-, Ballett- und Reiterass zu formen, und den entsprechenden niederschmetternden Rückmeldungen der Trainerinnen, die allesamt meinten, dass mir sowohl das Talent als auch jeglicher Ehrgeiz fehlten und ich zudem keinerlei Kontakt zu den anderen Sportlerinnen aufnehmen würde, ließ Dad mich schließlich in Ruhe. Danach behandelte er mich mit dieser gewissen Mischung aus mildem Erstaunen, Desinteresse und immer auch latent vorhandener Enttäuschung, bei der ich mich sofort unbehaglich fühlte.
Wenn ich wusste, dass mein Dad zu Hause war, ging ich ihm aus dem Weg. Was leicht war, da er sowieso die meiste Zeit in seinem Arbeitszimmer verbrachte. Gemeinsame Abendessen oder Ausflüge am Wochenende, wie wir sie gelegentlich gemacht hatten, als ich noch klein war, gab es schon lange nicht mehr.
Als kleines Kind hatte ich es geliebt, wenn meine Eltern am Wochenende mit mir an die Ostsee gefahren waren, die nur etwa zwei Stunden Fahrtzeit entfernt war. Im Auto durfte ich Hörspiele hören und Reiswaffeln essen und am Strand buddelte ich und hüpfte bei warmem Wetter in die Wellen, obwohl ich noch nicht richtig schwimmen konnte. Ich liebte das Wasser einfach schon immer. Mein Dad lachte und feuerte mich an, meine Mutter stand mit halb skeptischem, halb belustigtem Blick an der Wasserkante und hielt ein Handtuch für mich bereit. Wenn ich dann eingekuschelt in meinem blauen Bademantel mit den weißen Punkten zwischen ihnen im Strandkorb saß, diskutierten sie scherzhaft darüber, von wem ich diesen Spaß am Wasser und die Abenteuerlust im Meer geerbt hätte. Immer gewann mein Vater die Diskussion, der behauptete, er sei als Kind genauso gewesen, nur habe er sich schon mit fünf Jahren das Schwimmen selbst beigebracht, bis ich schrie: „Ich hab alles nur von mir selbst geerbt, und wenn ich groß bin, segele ich mit Pippi Langstrumpf nach Taka-Tuka-Land!“
Pippi war meine Heldin. Meine Mutter hatte mir alle Geschichten immer und immer wieder vorlesen müssen. Gerade weil ich eher der schüchternen, braven Annika glich, liebte ich die wilde, freche, mutige Pippi umso mehr.
Mit meiner Mutter war es anders als mit meinem Dad. Schon als kleines Kind hatte ich gelernt, viel Rücksicht auf sie zu nehmen. An manchen Tagen kümmerte sie sich hingebungsvoll um mich. Dann machten wir alles, was ich wollte. Wir backten Kuchen nach verrückten Rezepten, die ich mir selber ausdachte, und verwandelten die Küche in ein Schlachtfeld. Wir lachten und lachten, bis uns die Luft wegblieb. Oder wir verkleideten uns mit Mamas alten Hippieklamotten, die ganz hinten im Kleiderschrank hingen, und gingen so spazieren. Wenn uns dabei jemand begegnete und schief ansah, streckte ich ihm die Zunge heraus, und Mama lachte.
An solchen Tagen durfte ich so lange aufbleiben, wie ich wollte und abends vor dem Fernseher Eis essen, bis mir der Bauch wehtat. Ich liebte diese Tage. Sie kamen über mich wie ein unerwarteter Regenbogen nach einem langen Regen. Am nächsten Morgen wachte ich meistens hin- und hergerissen zwischen freudiger Erwartung, was ich mit meiner wunderbaren Mama heute wieder erleben durfte, und unruhiger Aufmerksamkeit, welche von den beiden Mamas, die ich kannte, mir heute begegnen würde.
Читать дальше