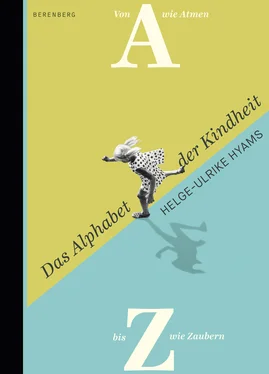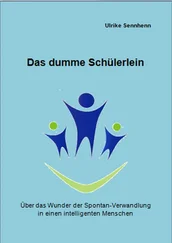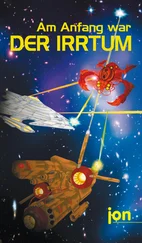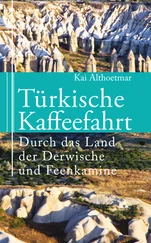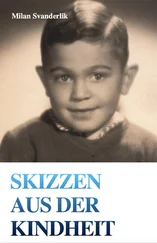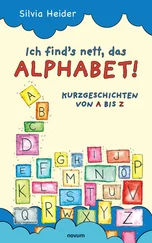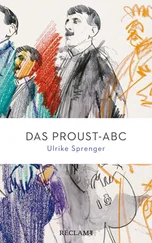Natürlich ist kein Kind so töricht, laut und offen davon zu sprechen. Wie so viele andere Dinge, die dem Kind heilig sind, hält es sein Wissen lieber geheim. Erst als Erwachsener schreibt deshalb der spanische Dichter Federico García Lorca diese Zeilen über die Pappeln seiner Kindheit: »Ich spreche heute zum ersten Male davon. Es hat immer nur mir allein gehört. Es war etwas so Intimes, Privates, dass ich es nicht einmal selbst analysieren wollte. Als Kind lebte ich inmitten der Natur. Wie für alle Kinder hatte auch für mich jedwedes Ding, jedes Möbel, jeder Gegenstand, Baum oder Stein, eine Persönlichkeit. Ich sprach mit ihnen und liebte sie. Im Hof unseres Hauses standen Pappeln. Eines Nachmittags kam es mir so vor, als wenn die Pappeln sängen. Der Wind zwischen den Zweigen erzeugte ein Geräusch aus verschiedenen Tönen – mir klang es wie Musik. Und ich begleitete das Lied der Pappeln oftmals viele Stunden mit meinem Gesang. Einmal hielt ich verblüfft inne. Da sprach jemand meinen Namen, jede Silbe für sich, als buchstabierte er: ›Fe-de-ri-co.‹ Ich sah mich um, aber da war niemand. Und doch zirpte mir jemand weiter meinen Namen ins Ohr.« 42
Der Baum besitzt seine reale Gestalt und gleichzeitig gibt er Raum für Projektionen aller Art. Jedes Kind sucht und findet in ihm genau das, was seine Seele braucht. Für Pippi Langstrumpf ist die Baumhöhle der Ort, an dem man die schönsten Schätze findet. Im Märchen vom Fundevogel wird das entführte Kind in einer Baumkrone versteckt, aber auch glücklich wieder entdeckt. Für manche Kinder ist der Baum das Objekt erster naturwissenschaftlicher Neugierde, es sammelt Bucheckern und Blätter, schnitzt sich Stöcke und zählt die Jahresringe. Kein Kind, das sich nicht danach sehnt, in einem Baumhaus zu thronen, und kein Kind, das nicht gierig ist nach den Früchten der Bäume, nach Äpfeln, Birnen und Nüssen.
Wir Erwachsenen vergessen leicht und müssen uns immer wieder zurückerinnern: Als Kind waren wir eins mit der Natur. Alles war in ihr lebendig. Wenn ein Baum gefällt wurde, dann spürten wir die Schmerzen körperlich, und manchmal weinten wir sogar. Heute gibt es nur noch wenige Familien, die zur Geburt des Kindes einen Baum pflanzen, und wenige Familien mit Gärten, auf deren Bäume die Kinder klettern können. Aber Bäume gibt es überall, an jeder Straßenecke, in jedem Park, an fast jedem Bahnhof oder städtischen Platz.
Eine Berliner Kindergruppe kam kürzlich auf die Idee, dass jedes Kind sich einen Patenbaum sucht, seinen Baum, der durchaus auf einem öffentlichen Gelände stehen kann. Jedes Kind darf mit seinem Baum irgendetwas Besonderes anstellen, ein Vogelhaus oder Schmuck an einen Ast hängen, Blumen pflanzen an seiner Wurzel. Manche haben ihren Baum gemalt oder fotografiert oder ihm einen Namen gegeben, kurz: Sie alle haben den Baum zu ihrem persönlichen Freund gemacht. Alles ist ein Spiel der Fantasie, aber diese Kinder sind nicht die ersten, die sich auf ihre Weise mit Bäumen verbinden. Schon in der Bibel finden wir sie, diese innere Nähe zu den Bäumen. Da gibt es die Geschichte von der Heilung des Blinden. Als dieser nach Jesus’ Handauflegen die Augen öffnet, sagt er staunend: »Ich sehe Menschen gehen, als sähe ich Bäume.« 43
Elliott: »E. T.! Bleib bei mir!
Bitte, bleib mit mir zusammen!«
Steven Spielberg
In Steven Spielbergs Film E. T . sucht ein kleiner Junge Freundschaft, Trost und Vertrauen bei einem Außerirdischen. Hier glaubt er das zu finden, was er in seiner eigenen Familie verzweifelt entbehrt: Bindung. Dieser Film aus dem Jahre 1982, ursprünglich als Kinderfilm konzipiert, hat seine erwachsenen Zuschauer nicht weniger angerührt als die jungen. Das lag sicher nicht nur an Spielbergs Regiekunst, vielmehr spürte jeder Kinobesucher, ob groß oder klein, dass die dramatische Geschichte um E. T. eine tiefe, universale Wahrheit vermittelt: Kein Kind auf Erden kann und will aus freien Stücken allein sein. Jedes Kind will zusammen sein, in Bindung sein: mit einem Menschen, mit einem Tier, mit seiner Facebook-Freundesschar – und notfalls mit einem Außerirdischen. Das ist die Botschaft des Films, und das hat die Menschen, als sie E. T. im Kino sahen, zum Weinen gebracht. 44
Die Erklärung für diese Botschaft liegt nahe. Bindung ist, vom Anfang unseres Lebens an, eine absolute Notwendigkeit. Das Neugeborene muss vom ersten Augenblick an angenommen, gefüttert, gewärmt und versorgt werden, um zu überleben. In einem sensiblen, über Wochen und Monate währenden Einigungsdialog 45weben Mutter und Kind das erste Band, welches das Muster für alles spätere Bindungsverhalten abgibt. 46Im Normalfall sind die Mutter und auf seine Weise der Vater von sich aus auch gern bereit, diese Bindung mit dem Kind einzugehen, es zu nähren, zu schützen, und sie werden dafür reichlich belohnt.
Was ist das Wesen der Bindung? Wie können wir sie begreifen, fernab all der wissenschaftlichen Definitionen, in denen man sich so leicht verlieren kann? Vielleicht sollten wir beginnen mit dem, was Bindung nicht ist. Bindung ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Liebe und Glück. Interessanterweise – oder sollten wir etwa sagen klugerweise? – bindet sich das Kind anfangs an jeden, der es versorgt und schützt, selbst wenn dies ohne Zeichen von Liebe geschieht und ihm dabei Leid oder Schmerz widerfährt. Es bindet sich auch an Tiere, wie die Geschichten der sogenannten Wolfskinder beweisen. Die Hauptsache ist, in Bindung zu sein, im Schutz und Teil einer Gruppe zu sein. Liebe, Glück und Wohlbehagen sind zwar die erfreulichen und auch häufigsten Beigaben, aber sie sind trotz allem nicht unerlässlich, nicht lebensnotwendig. (Dies ist übrigens der Grund, weshalb im Erwachsenenalter viele Menschen sich an Personen, Orte und Situationen klammern, selbst wenn sie ihnen schaden oder sie gar in Lebensgefahr bringen.)
Lebensnotwendig ist die Bindung selbst. Und da ist es sinnvoll zu unterscheiden zwischen jener Urbindung, der in der Mutter-Kind-Beziehung angelegten Matrix einerseits und dem daraus resultierenden Bindungsverhalten andererseits. Die Bindung ist für das Auge unsichtbar – wie farbloser Klebstoff –, aber höchst wirksam. Sichtbar ist hingegen das wechselnde Verhalten. Bindung erscheint in den unterschiedlichsten Gewändern, sie äußert sich in Sprache, in Gesten und in Taten.
Jede Bindung hat ihre Zeit. Und wenn diese Zeit vorbei ist, müssen alte Bindungen aufgelöst und durch neue eingetauscht werden – ein überaus empfindsamer Prozess für beide Seiten. In den seltensten Fällen geht die Auflösung eines bestehenden Arrangements reibungslos vor sich, ja, die Reibung ist geradezu ein Zeichen dafür, dass eine alte Bindung überholt ist. Wenn dieses seismografische Spüren versagt, wenn Bindungen nicht gelöst werden, kann dies lebenslange und sogar krankmachende Folgen haben.
Zum Glück ist das Kind auch selbst aktiv. Es fordert uns dauernd heraus. Und auch ohne die unmittelbare Gegenwart von Menschen kann es sich in Bindung einüben. Wenn man es lässt, erschafft es sich im Spiel und in der Fantasie ganz ungeahnte Formen von Bindung. Denken wir nur an Christopher Robin, der seinen Bären Pu schuf – mal ungeachtet der Tatsache, dass es der eigene Vater war, der die Geschichte niederschrieb. 47Oder an Anne Frank, die sich, allein und abgeschnitten von Vergangenheit und Zukunft, ihre Brieffreundin Kitty erdichtete, zu der sie in ihrem Amsterdamer Versteck die tiefste und offenherzigste Bindung pflegte. Dass Annes Tagebuch ein so überwältigender Erfolg war, verdankt es sicher nicht nur den tragischen Verhältnissen, unter denen es entstand, sondern vor allem dieser Kraft, gegen die Hoffnungslosigkeit anzuschreiben. 48Anne Frank wollte die Bindung zur Welt niemals aufgeben.
Читать дальше