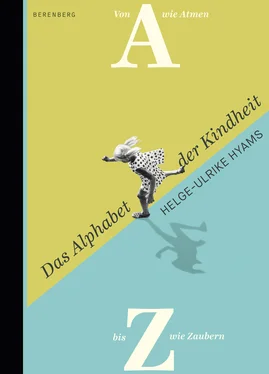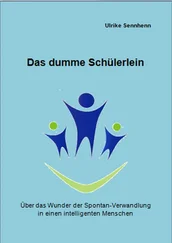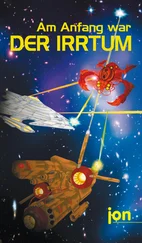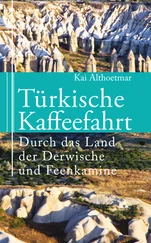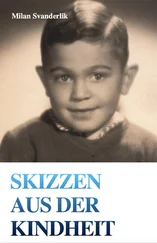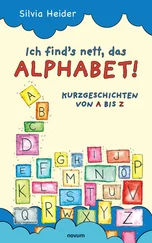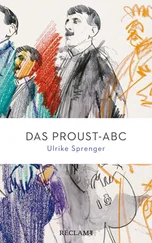1 ...7 8 9 11 12 13 ...23 Doch es gibt auch die anderen Brot-Bilder, die der Entbehrung. Wenn Brot so zentral ist für unser Leben, dann ist es auch immer gleichzeitig bedroht – wie das Leben selbst. Eine Radierung von Käthe Kollwitz zeigt zwei kleine Mädchen, deren Arme sich um die Mutter schlingen und die nach Brot schreien. Viel zu viele Kinder in der Welt haben kein Brot. Sie erleben Hunger als täglichen Begleiter des Alltags. Der kurdische Schriftsteller Hiner Saleem schreibt dazu in seinen Lebenserinnerungen: »Es dauerte nicht lange, und wir hatten nur noch Brotfladen zu essen, die wir mit Tee herunterspülten, und auch das nur einmal am Tag. Wenn ein Krümel auf den Boden fiel, hob ich ihn aus Achtung vor dem Brot auf, küsste ihn und hielt ihn an meine Stirn, ehe ich ihn aß. Brot ist heilig.« 55
Es ist schmerzlich zu erleben, wie die Kluft zwischen denen, die Brot haben und jenen, denen es daran mangelt, unentwegt größer wird. Hier dürfen wir nicht stumm bleiben. Wir sollten unsere Kinder von Anfang an nachhaltig lehren, dass es keineswegs selbstverständlich ist, sein Brot auf dem Teller oder in der Brottasche oder im Mund zu haben. »Unser täglich Brot gib uns heute.« Brot ist das Resultat eines langen und mühsamen Arbeitsprozesses vieler daran beteiligter Menschen und vor allem viel Segen von oben.
»Eine einzige Kurve – nicht eine gerade Linie –, die auf eine flache Oberfläche gezeichnet ist, spielt bereits mit der besonderen Kraft der bildhaften Darstellung. Die Kurve bleibt auf der Oberfläche haften – wie etwa der geschriebene Buchstabe C – zugleich aber kann sie sich von ihr abheben und durch einen Körper ausgefüllt werden – es kann ein Kiesel, eine Orange, eine Schulter sein.«
John Berger
»Was die Anziehung einer Bande ausmacht? Sich in ihr aufzulösen mit dem Gefühl, die eigene Person zu befestigen. Die wunderbare Illusion einer Identität.«
Daniel Pennac
Irgendwann in der Mitte der Kindheit, zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr, lockern Kinder die Bindungen zu ihren Eltern. Sie hinterfragen deren Aussagen (»Seid ihr wirklich meine richtigen Eltern?«), sie bezweifeln ihre Wahrhaftigkeit (»Vorgestern hast du etwas ganz anderes gesagt.«) und die Verbindlichkeit ihrer Weisungen (»Warum muss ich etwas tun, was die anderen nicht müssen?«). Sie entdecken Widersprüche zwischen Worten und Handlungen der Erwachsenen. Sie reiben sich an den Erklärungen der Eltern über Gott und die Welt und erahnen deren Grenzen – und womöglich damit auch ihre eigenen.
Mitunter kann der Schrecken darüber groß sein und die Kinder in Resignation stürzen. Welches Glück aber, wenn sie in dieser Situation ihresgleichen entdecken, Jungen und Mädchen, möglichst gleichen Alters und gleichen Geschlechts (wobei beides nicht zwingend sein muss), auf jeden Fall Kinder, die sich in ähnliche Widersprüche verwickelt fühlen und ebenfalls Halt in einer Gruppe suchen.
Das nämlich ist genau der Sinn der Clique: das Kind aufzufangen in dieser Phase der Verunsicherung und des Übergangs. Bevor es seine ganz eigene, persönliche Identität gefestigt hat und bevor es seinen eigenen Lebensweg (meist gekoppelt an die Berufswahl) einschlägt, darf das Kind beziehungsweise nunmehr der Jugendliche eine Zeitlang in dieser »wunderbaren Illusion einer Identität« 56in der Clique schwimmen.
Und die meisten tun dies auch. Sie schaffen sich einen Raum, in dem die Vorgaben von Familie und Schule nicht gelten, nach eigenen Vorstellungen, mit eigenen Gesetzen, manchmal einer eigenen Sprache (Geheimsprache), mit Ritualen, die nur sie kennen – und schließlich einer eigenen Moral. Eine Moral, die mitunter eigenwillig, auch hart sein kann, beispielsweise wenn es darum geht, unerwünschte Mitglieder aus der Clique auszuschließen oder andere, die dazugehören wollen, gar nicht erst zuzulassen. Außenstehende bekommen dieses »Du gehörst nicht dazu!« gnadenlos zu spüren. Wir sollten diese Art der Gruppenbildung als sinnvolles, vielleicht sogar notwendiges Durchgangsstadium zur Reifung, auch der Initiation, begreifen. 57In der Clique wagt man sich gemeinsam vor. Falls etwas schiefgeht, springt die Gruppe ein. Sie definiert, wie weit man gehen darf. Und manche gehen dabei bis hin zur Selbstgefährdung oder gar Selbstdestruktion. Aber auch dies – und gerade dies – gehört zur Pubertät, und wer allein nicht die nötige Kraft hat, seine Grenzen auszuloten, der holt sie sich bei den Altersgenossen.
Genau wie der Beginn der Cliquenbildung in der Mitte der Kindheit einer Notwendigkeit entspringt, so fügt sich auch ihr Ende meist biografisch logisch ein. Irgendwann wird sie überflüssig. Am ehesten erledigt sie sich, wenn sich Jungen und Mädchen verlieben. Da ändert sich plötzlich alles. Alle Wahrnehmung der Welt und seiner selbst. Jetzt geht es nicht mehr darum, in einer Gruppe unterzutauchen, jetzt ist genau das Gegenteil gefordert: sich persönlich einbringen, sich ganz zu erkennen geben, eine individuelle Sprache finden, die auf das Du gerichtet ist. Kein Verstecken mehr hinter der Gruppe. Das ist Wachstum. Das ist Reifung. 58Und die Clique war – rückblickend – ein wunderbares, nicht zu missendes Zwischenspiel.
»Die Mathematik ist das Alphabet ,
mit dem Gott die Welt erschaffen hat.«
Galileo Galilei
»Er legte sich hinter den Grashalm, um den Himmel zu vergrößern.«
Noël Bureau
Eigentlich braucht es nicht mehr als diesen Satz von Noël Bureau, um das Wesen des Däumlings – und womöglich des Kindes – zu erfassen. Alle Kinder sind Däumling.
Indes, der Psychoanalytiker Otto Rank weist uns auf einen verblüffenden Aspekt der Däumlingsexistenz hin, den wir wohl zu kennen glauben, der uns allerdings so abwegig fern ist, dass wir ihn zumeist aus unserem Gedankengut verbannt haben (nur der Neurotiker erlaubt sich, wie wir sehen, dieses Hirngespinst). Otto Rank schreibt über den Däumling, »der merkwürdigerweise ebenso spielend die unmöglichsten Aufgaben löst. Seine ›Tumbheit‹ ist aber nichts anderes als ein Ausdruck seiner Kindlichkeit, er ist auch ein infans , so unerfahren wie der neugeborene Gott Horus, der mit dem Finger im Mund dargestellt wird. Je dümmer, also je kindlicher er ist, desto eher gelingt ihm die Erfüllung des Urwunsches, und hat er gar nur die Größe der ersten Embryonalzeit, wie der Däumling unseres Märchens, dann ist er beinahe allmächtig und hat den Idealzustand erreicht, von dem noch der Neurotiker so häufig träumt und den die neugeborenen mythischen Helden zu verkörpern scheinen: nämlich wieder ganz klein und dabei doch aller Vorteile des Erwachsenen teilhaftig zu sein.« 59
Aber sind es wirklich nur die Neurotiker, die davon träumen?
»Halt dich gerade!«
Film Club der toten Dichter
Disziplin ist ein heißes Thema. Nicht nur in unserem Lande, überall in der Welt. Als vor einigen Jahren ein verbissenes Plädoyer für eine Art Disziplindiktatur zum amerikanischen Bestseller avancierte, spaltete dies nicht nur die amerikanische Nation, sondern erregte auch die deutschen Gemüter. 60Brauchen wir nicht doch ein bisschen mehr – oder sogar gewaltig mehr – Disziplin in unseren Kitas und Schulen, damit unsere Kinder ihren Weg ins Leben besser schaffen? Und als Hintergedanken: damit den Eltern und Lehrern das Leben etwas leichter gemacht wird?
Vorweg: Dass wir ein Mindestmaß an Disziplin benötigen, um in sozialen Gruppen zu leben und selbst sozial sein zu können, versteht sich. Wir müssen regelmäßig die Mülleimer rausstellen, wir müssen Formulare ausfüllen, morgens aufstehen und zur Arbeit gehen – all das ordnet und strukturiert unsere Gemeinschaft. Was aber die Kinder anbelangt und die frühen Erziehungsprozeduren, sie zu disziplinieren, so sollten wir doch achtsam sein. Was auf den ersten Blick als Wohltat für das Kind erscheint (»Es ist doch zu deinem Besten!«), kann sich unter der Hand leicht in das Gegenteil wenden, dem Kind schaden. Betrachten wir folgende drei Kinderszenen:
Читать дальше