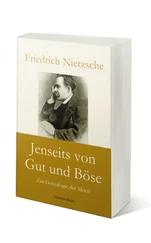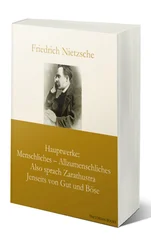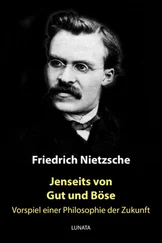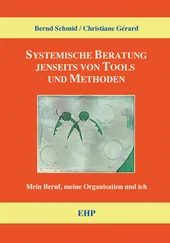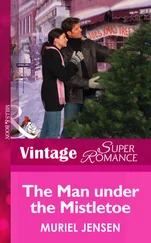2.2.3 Non-Intentionalität
Nach Hausenblas und Symons Downs (2002a) umschreiben »intention effects« die Tatsache, dass die Betroffenen länger, umfangreicher oder intensiver Sport treiben, als sie dies eigentlich beabsichtigten (d. h. »intendierten«). Offensichtlich fehlt Sportsüchtigen die Fähigkeit, ihr Verhalten willentlich zu steuern (Freimuth et al. 2011). Oder anders: Die Steuerung des Verhaltens ist stattdessen gefühlsbetont (»Affektregulation«). Ziel dieser Verhaltenssteuerung ist es somit, positiven Affekt zu erlangen (reward craving), also zum Beispiel eine euphorisierende Wirkung zu erreichen (was häufig mit subjektiv »Kick« oder »Adrenalinschub« bezeichnet wird). Um derartige Gefühle zu erlangen, können die Aktivitäten weit über das hinausgehen, was eigentlich geplant war. Ebenso gefühlsbetont und ähnlich non-intentional ist es, wenn die Betroffenen durch die körperliche Aktivität negative Affekte (bzw. Entzugssymptome) lindern (s. oben »relief craving«) oder das Auftreten von negativem Affekt »prophylaktisch« verhindern wollen.
Kontrollverlust beschreibt den starken Wunsch oder die erfolgslosen Versuche, den Umfang oder die Intensität des Sporttreibens zu reduzieren (Hausenblas und Symons Downs 2002a). Erfolglose Versuche, Sport oder Bewegung einzugrenzen, können darin bestehen, dass Sportabstinenz gar nicht oder nur für kurze Zeit bzw. innerhalb eines gewissen Zeitraums möglich war. Bislang liegen keine ausreichenden oder konsistenten Erfahrungen darüber vor, wie sehr Kontrollverlust bei Sportsüchtigen ausgeprägt ist und wie relevant dieses Kriterium bei der Beurteilung von Sportsucht ist. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist, dass das Sporttreiben bei Sportsüchtigen nicht als Kontrollverlust, sondern als Kontrollgewinn erlebt wird, da durch die körperliche Aktivität ein Gefühl der Kontrolle über den eigenen Körper erlebt und angestrebt wird (s. hierzu auch Hinweise zum Kontrollverlust im Kapitel 4.3 zu Essstörungen).
In der Sportsuchtliteratur wird das Thema Aufwand zumeist mit dem Zeitumfang in Verbindung gebracht, den Sportsüchtige mit sportlichen Aktivitäten verbringen (Hausenblas und Symons Downs 2002a). In Bezug auf das Sporttreiben selbst ist bereits weiter oben beschrieben worden, dass hohe Umfänge der Sport- und Bewegungsaktivität kein hinreichendes Kriterium für Sportsucht sind (  Kap. 2.1.1). Sport- und Bewegungsumfänge müssen individuell unter Berücksichtigung der Lebenssituation, des Leistungsniveaus und der biopsychosozialen Begleitumstände (z. B. Verletzungen, Stimmungslage, soziale Situation) eingeschätzt werden.
Kap. 2.1.1). Sport- und Bewegungsumfänge müssen individuell unter Berücksichtigung der Lebenssituation, des Leistungsniveaus und der biopsychosozialen Begleitumstände (z. B. Verletzungen, Stimmungslage, soziale Situation) eingeschätzt werden.
Im Rahmen der Diskussion um Zeitaufwände wird allerdings vernachlässigt, dass die zeitlichen Aufwände nicht nur das Sporttreiben selbst, sondern auch verschiedene Aktivitäten betreffen, die in engem Bezug zum Sport stehen. Hierbei spielen zum Beispiel organisatorische Aufwände für die Planung und Vorbereitung des Sporttreibens eine Rolle. Solche Aufwände betreffen den »sportfreien« Alltag, insbesondere die Trainingsplanung, Trainingskontrolle oder die Beschaffung von Sportausrüstungen oder Hintergrundinformationen. Durch diese Aktivitäten übernimmt der Sport die Vorherrschaft im Alltag der Patienten (Bamber et al. 2000; Bamber et al. 2003) und verdrängt andere wichtige Aspekte und Lebensbereiche.
Ein wichtiger Lebensbereich, der hiervon betroffen ist, ist das Ernährungsverhalten. Ernährung und Essen sind nicht nur bei der sekundären Sportsucht relevant (in Form einer vorliegenden Essstörung), sondern betreffen vermutlich alle Sportsüchtigen. Der Grund hierfür liegt in der engen Verbindung von Ernährung und Sport, die bereits bei unauffällig Sporttreibenden zu beobachten ist (Beschäftigung mit Vitaminen/Spurenelementen, Eiweißen [insbes. Kraftsportarten] oder Kohlenhydraten [Ausdauersportarten]). Darüber hinaus sollte angemessene Ernährung insbesondere bei intensiver Sportaktivität gut organisiert sein. Vermutlich ist diese Organisation im Falle eines gestörten Sportverhaltens ebenfalls beeinträchtigt, was zu einer unangemessenen Fixierung auf Ernährung und in der Folge auch zu hohen diesbezüglichen Aufwänden führen kann (bis hin zur Einnahme illegaler Substanzen). Denkbar ist sogar, dass derartige Entwicklungen dazu führen, dass sich sekundäre Essstörungen ausbilden.
2.2.6 Soziale Vernachlässigung und Konflikt
Soziale Vernachlässigung und Konflikt beschreibt die Beobachtung, dass angesichts des Vorherrschens der Sport- und Bewegungsaktivität wichtige soziale oder berufliche Aktivitäten und Lebensbereiche in den Hintergrund treten (Hausenblas und Symons Downs 2002a). Diese Vernachlässigung des sonstigen Lebens ist besonders bedeutsam im familiären oder partnerschaftlichen Umfeld; allerdings sind auch Ausbildung, Beruf und die Freizeitaktivitäten hiervon in typischer Weise betroffen.
Der Konflikt tritt sowohl intrapsychisch als auch zwischenmenschlich (interpersonal) in Erscheinung. Der intrapsychische Konflikt äußert sich dadurch, dass die Betroffenen das Zurückdrängen der anderen Lebensbereiche bewusst wahrnehmen und ein innerer Kampf zwischen konkurrierenden Bedürfnissen und Wünschen stattfindet. In diesem Kampf unterliegen zumeist die sozialen Bedürfnisse zu Gunsten der suchtgebundenen Motive. Der zwischenmenschliche Konflikt äußert sich in Streitigkeiten mit dem Partner, der Familie oder dem Freundeskreis (Veale 1995; Grüsser-Sinopoli et al. 2006), die dadurch entstehen, dass die sozialen Bezugspersonen wahrnehmen, zurückgewiesen zu werden und entsprechend mehr Zeit und Raum einfordern. Darüber hinaus entstehen berufliche Konflikte dadurch, dass sportbedingt Aufmerksamkeit und Engagement sinken können, was zu nachlassenden Leistungen bzw. Fehlern führt.
2.2.7 Maladaptive Kontinuität
Von maladaptiver Kontinuität kann gesprochen werden, wenn das Sport- und Bewegungsverhalten auch dann noch ausgeführt wird, wenn negative psychische und/oder körperliche Konsequenzen bereits bestehen oder sich verstärken bzw. auftreten können. In körperlicher Hinsicht wird dies besonders deutlich beim Thema Verletzungen und Beschwerden. Die Betroffenen trainieren trotz Verletzungen und Beschwerden weiter, was dadurch erklärt wird, dass diese bagatellisiert oder sogar ignoriert werden (Adams und Kirkby 1998). Selbst von ärztlicher Seite strikt empfohlene Zwangspausen werden nicht eingehalten und missachtet (Adams und Kirkby 1998). Hiermit verbunden ist die Unterschätzung von Erholungs- und Regenerationsphasen. Hierdurch bedingt kann es neben orthopädischen Problemen auch zu Beschwerden der inneren Organe bis hin zu Erkrankungen infolge eines geschwächten Immunsystems kommen. Da in schweren Fällen solche Probleme entweder ignoriert oder nicht genügend auskuriert werden, sind massive Gefährdungen der Gesundheit denkbar.
In das zuvor beschriebene Symptomfeld gehört auch das Thema Schmerzmittel. Durch Schmerzmittel oder entzündungshemmende Mittel (insbesondere nichtsteroidale Analgetika, Kortikoide bis hin zu Antibiotika) werden Beschwerden bekämpft, was in zweifacher Hinsicht problematisch ist. Zum einen werden auf diese Weise wichtige, warnende Schmerzsignale ausgeschaltet, was die Überforderung verstärkt. Zum zweiten geht der Substanzkonsum selbst mit teils drastischen Nebenwirkungen einher, die eine zusätzliche gesundheitliche Gefährdung darstellen.
2.3 Bedeutung von Suchtkriterien für die Sportsucht
Die Bedeutung der verschiedenen Suchtkriterien (  Tab. 2.1) für den speziellen Fall der Sportsucht ist abschließend nicht geklärt. Grundsätzlich muss hervorgehoben werden, dass die genannten Kriterien nicht als obligate (also in allen Fällen vorliegende) Kriterien zu verstehen sind. Stattdessen kann eine Sportsucht auch vorliegen, wenn nur einige der genannten Kriterien zutreffen. Sportsucht ist demnach immer ein Symptomkomplex (d. h. ein Syndrom), der aber bei verschiedenen Betroffenen unterschiedliche Symptome einbezieht. Daher legten Hausenblas und Symons Downs (2002a) fest, dass von den sieben Kriterien der Sportsuchtliteratur (
Tab. 2.1) für den speziellen Fall der Sportsucht ist abschließend nicht geklärt. Grundsätzlich muss hervorgehoben werden, dass die genannten Kriterien nicht als obligate (also in allen Fällen vorliegende) Kriterien zu verstehen sind. Stattdessen kann eine Sportsucht auch vorliegen, wenn nur einige der genannten Kriterien zutreffen. Sportsucht ist demnach immer ein Symptomkomplex (d. h. ein Syndrom), der aber bei verschiedenen Betroffenen unterschiedliche Symptome einbezieht. Daher legten Hausenblas und Symons Downs (2002a) fest, dass von den sieben Kriterien der Sportsuchtliteratur (  Tab. 2.1, linke Spalte) gleichzeitig drei oder mehr beliebige Kriterien vorliegen müssen, um eine Sportsucht annehmen zu können. In Hinsicht auf den neuen Katalog des DSM-5 (
Tab. 2.1, linke Spalte) gleichzeitig drei oder mehr beliebige Kriterien vorliegen müssen, um eine Sportsucht annehmen zu können. In Hinsicht auf den neuen Katalog des DSM-5 (  Tab. 2.1, mittlere Spalte) wurde eine Einteilung der Symptomatik in »mild« (2–3 Kriterien), »moderat« (4–5 Kriterien) und »schwer« (mindestens 6 Kriterien) vorgenommen.
Tab. 2.1, mittlere Spalte) wurde eine Einteilung der Symptomatik in »mild« (2–3 Kriterien), »moderat« (4–5 Kriterien) und »schwer« (mindestens 6 Kriterien) vorgenommen.
Читать дальше

 Kap. 2.1.1). Sport- und Bewegungsumfänge müssen individuell unter Berücksichtigung der Lebenssituation, des Leistungsniveaus und der biopsychosozialen Begleitumstände (z. B. Verletzungen, Stimmungslage, soziale Situation) eingeschätzt werden.
Kap. 2.1.1). Sport- und Bewegungsumfänge müssen individuell unter Berücksichtigung der Lebenssituation, des Leistungsniveaus und der biopsychosozialen Begleitumstände (z. B. Verletzungen, Stimmungslage, soziale Situation) eingeschätzt werden.