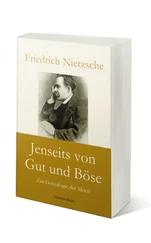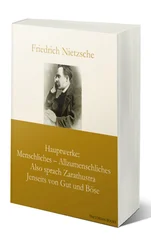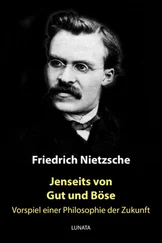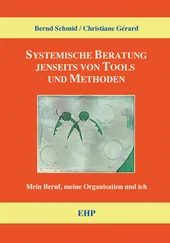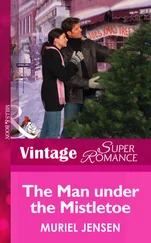Auch in der Sportsuchtforschung finden sich Hinweise darauf, dass der bloße Umfang von Sport sich kaum als Kriterium für Sportsucht eignet (Bamber et al. 2003). So fanden Davis et al. (1993) heraus, dass zwischen Sportumfang und anderen Suchtsymptomen nur geringe Zusammenhänge bestehen. Andersherum stellt sich die Frage, ob eine Sportsucht auch bei einem geringen Umfang von Sport bzw. körperlicher Aktivität denkbar ist. Auch wenn hierzu bislang keine abschließende Antwort vorliegt, kann angenommen werden, dass (sehr) niedrige Sportumfänge das Vorliegen einer Sportsucht ausschließen (siehe aber besondere Aspekte des zwanghaften Sporttreibens bei Essstörungen,  Kap. 4.3). Die Erfassung von Sportumfängen könnte daher meist zwar als Ausschlusskriterium dienen, aber kaum als hinreichendes Kriterium für Sportsucht.
Kap. 4.3). Die Erfassung von Sportumfängen könnte daher meist zwar als Ausschlusskriterium dienen, aber kaum als hinreichendes Kriterium für Sportsucht.
Neben dem Begriff des exzessiven Sporttreibens ist der Begriff der Maladaptivität in Definitionen der Sportsucht sehr häufig zu finden (De Coverley Veale 1987; Hausenblas und Symons Downs 2002a). So beschreiben Symons Downs, Hausenblas und Nigg Sportsucht als »maladaptive pattern of excessive exercise behavior that manifests in physiological, psychosocial, and cognitive symptoms« (Symons Downs et al. 2004, S. 185). Von Maladaptivität kann dann gesprochen werden, »wenn das Sport- und Bewegungsverhalten die persönliche Entwicklung des Betroffenen langfristig und maßgeblich beeinträchtigt, behindert oder unterdrückt« (Kleinert 2014, S. 169). Diese negative Auswirkung des exzessiven Sport- oder Bewegungsverhaltens auf die eigene Entwicklung kann daher auch als Leitkriterium für die klinische Relevanz der Sportsucht dienen (Kleinert et al. 2013).
Die Ausprägungen von Maladaptivität sind ebenso wie die Ausprägungen von Entwicklungsprozessen mehrdimensional (d. h. körperlich, psychisch und sozial). In körperlicher Hinsicht zeigt sich eine maladaptive Entwicklung beispielsweise in häufigen Verletzungen oder Erkrankungen, die sich daraus ergeben, dass die Betroffenen zu viel trainieren und sich körperlich überfordern oder schwächen (z. B. mit negativen Auswirkungen auf den Bewegungsapparat oder auch das Immunsystem). In psychologischer Hinsicht könnten sich maladaptive Entwicklungen darin zeigen, dass das Selbst- und Körperkonzept leidet (z. B. Abhängigkeit des Selbstwerts von sportlicher Aktivität, depressive Stimmungslage, wenn kein Sport getrieben werden kann); aus sozialer Sicht sind typische Anzeichen einer maladaptiven Entwicklung Probleme in der Familie, in der Ausbildung oder im Beruf (z. B. Konflikte in Beziehungen aufgrund der hohen Bedeutung des Sports, sozialer Rückzug oder Vernachlässigung der beruflichen Ausbildung).
Wenn Sporttreiben nicht nur nach seinem Umfang, sondern nach seiner Bedeutung im Rahmen der Entwicklung des Betroffenen beurteilt wird, ist eine Unterscheidung von »normalem« und »krankhaftem« Sport- und Bewegungsverhalten deutlich einfacher: »In light of this definition pathogenic exercisers could be distinguished from the other high-volume exercisers, like athletes, who maintain control over their training, have a fixed schedule of training to also meet other life-obligations, and encounter no harmful or negative consequences as a result of their intensive training« (Egorov und Szabo 2013, S. 200).
2.1.3 Leidensdruck und Krankheitseinsicht
Neben dem Merkmal der Maladaptivität wird im Zusammenhang mit Suchtverhalten auch der Leidensdruck der Betroffenen hervorgehoben. Der subjektive Leidensdruck beschreibt ein Gefühl der Betroffenen, dass das Verhalten ihnen schadet, ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung darunter leiden und dass sich etwas ändern muss. Diese Gefühlslage wird auch in einem 2016 veröffentlichten Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) als mitentscheidendes Kriterium zur Bestimmung einer krankhaften Verhaltenssucht (im Vergleich zum unproblematischen Verhalten) betont (DGPPN 2016). Andererseits ist gerade bei der Sportsucht nicht selten, dass ein (nach objektiven Kriterien) offensichtlich problematisches Sport- oder Bewegungsverhalten (anfänglich) ohne Leidensdruck besteht. Leidensdruck ist daher zwar ein sehr bedeutsames Merkmal, kann jedoch vermutlich nicht in jedem Stadium einer Sportsucht als zwingend notwendig (d. h. obligat) bezeichnet werden.
Das Ausmaß des Leidensdrucks geht einher mit dem Ausmaß an negativem Affekt (d. h. negativer Gefühlslage), der mit dem Sport und der körperlichen Aktivität in Verbindung steht. Dieser negative Affekt kann sich auf den Sport selbst beziehen (z. B. ein Gefühl des Zwangs und des Sportreiben-Müssens) oder auch auf das Gefühl, durch den Sport wichtige Bedürfnisse nicht befriedigen zu können (z. B. Vernachlässigung von Familie und Freunden). Da zugleich bei Sportsüchtigen der Sport die hauptsächliche Möglichkeit ist, negative Affekte zu regulieren (also sich besser zu fühlen), entsteht ein innerer Konflikt zwischen dem Nicht-Wollen (weil Sport der Entwicklung nicht guttut) und dem Müssen (aufgrund des Zwangsgefühls). Dieser Konflikt geht mit einer starken Spannungslage einher (d. h. Dissonanz), die selbst wieder als unangenehm erlebt wird.
In den Fällen von Sportsucht, in denen Leidensdruck ausgeprägt ist, führt dieser dazu, dass zunehmend auch eine rationale Krankheitseinsicht entsteht. Das heißt, dass die Betroffenen nicht nur fühlen, sondern auch wissen, dass sich etwas ändern muss. Diese rationale Krankheitseinsicht führt in solchen Fällen dazu, dass eine Behandlung nicht nur akzeptiert, sondern oft auch gewünscht wird. Wie häufig und wie stark dieser Behandlungswunsch vorliegt, ist empirisch nicht gesichert – aus der klinischen Praxis werden häufig Fälle von Sportsucht ohne Leidensdruck geschildet.
Zwangserleben ist dadurch charakterisiert, dass die Betroffenen das Gefühl haben, nicht Herr über die eigene Entscheidung zum Sporttreiben zu sein. Stattdessen erleben die Betroffenen ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Mit anderen Worten: Die Betroffenen beherrschen nicht den Sport, sondern fühlen sich vom Sport beherrscht (  Kap. 2.2.3zu Non-Intentionalität und
Kap. 2.2.3zu Non-Intentionalität und  Kap. 2.2.5zu Aufwand).
Kap. 2.2.5zu Aufwand).
Die Rolle des Zwangs als Bestimmungsmerkmal der Sportsucht ist nicht eindeutig geklärt und wird in der Fachliteratur entsprechend unterschiedlich gesehen. Auf der einen Seite wird das Zwangserleben als bedeutsamer und wichtiger Bestandteil der Sportsucht beschrieben – so bereits in den frühen Veröffentlichungen von Morgan (1979). Auf der anderen Seite wird der Zwang vielfach nicht mehr als Kardinalsymptom bezeichnet und stattdessen in abgeschwächter Form von fehlender Absicht (intention effects) gesprochen (Symons Downs et al. 2004). Es lassen sich demnach zwei Lager beschreiben: Die einen Autoren sehen den erlebten Zwang zum Sporttreiben als ein notwendiges Kriterium an (De Coverley Veale 1987; Gulker et al. 2001; Taranis et al. 2011a), während andere verschiedene Formen der Sportsucht favorisieren, die mehr oder weniger mit dem Phänomen des Zwangs verbunden sind (Davis et al. 1993, S. 613; Freimuth et al. 2011, S. 4071; Kleinert et al. 2013; Kleinert und Wasserkampf 2016;  Kap. 4.1).
Kap. 4.1).
2.2 Kriterien der Sportsucht
Читать дальше

 Kap. 4.3). Die Erfassung von Sportumfängen könnte daher meist zwar als Ausschlusskriterium dienen, aber kaum als hinreichendes Kriterium für Sportsucht.
Kap. 4.3). Die Erfassung von Sportumfängen könnte daher meist zwar als Ausschlusskriterium dienen, aber kaum als hinreichendes Kriterium für Sportsucht.