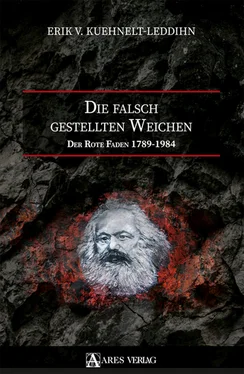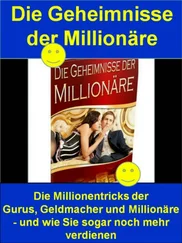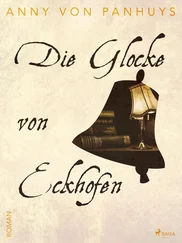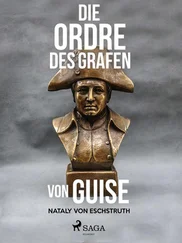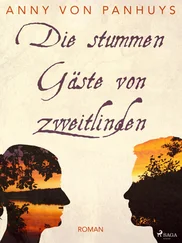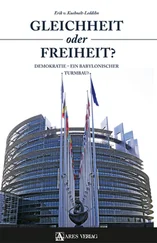Man kann sich leicht vorstellen, daß diese fortwährenden Einbrüche und Überlagerungen dazu führten, daß in einer gewissen Beziehung rassische Unterschiede mit Klassengegensätzen verbunden sind, wobei freilich auch geographische Differenzen eine gewisse Rolle spielten. So ist natürlich der Anteil von „nordischen“ Typen in Ost-England viel höher als im Westen und (besonders) in Wales, wo sich bis auf den heutigen Tag die keltische (walisische) Sprache sehr wohl erhalten hat und von einer dreiviertel Million gesprochen 5)wird. Und gerade in Wales fällt die eher klein geratene, schwarzhaarige und dunkeläugige Urrasse stark auf. Die englischen Standesunterschiede sind allerdings nicht nur visuell (wobei es überraschende Ausnahmen gibt), sondern vor allem auch sprachlich und selbstverständlich in Bildung und Manieren. 6)Gerade deswegen, weil die Adelstitel so spärlich gesät sind – sie gehen bei den nachgeborenen Söhnen und bei der Mehrzahl der Enkel wieder verloren –, werden die spezifischen Manierismen der Oberschichte „subtil betont“ und schaffen gesellschaftliche Abgründe, die natürlich im sozialen Aufstieg wieder überbrückt werden. 7)Hier aber muß auch bemerkt werden, daß das „Aufschauen“ der Unterschichten zu den gesellschaftlich Hoch- und Höchstgestellten mit der Zeit geringer und geringer, der Neid und die Animosität aber (besonders von der Arbeiterschaft zu den Managern und Unternehmern) größer und größer wurden. Heute kann man in England von einem Klassenkampf reden, in dem aber der Adel nur mehr Zuschauer ist.
Im 19. Jahrhundert spielte auch das Empire („Weltreich“) eine große psychologische eher denn wirtschaftliche Rolle. Über die Kolonien und den „Kolonialismus“ werden wir später reden müssen. Es genüge aber hier zu sagen, daß die Möglichkeit, im sehr fernen Ausland interessante Aufgaben und einen erweiterten Horizont zubekommen, für Engländer von größter Wichtigkeit war. Doch war das britische Kolonialsystem sehr anders als das alte spanische, das portugiesische oder auch das französische – allerdings nicht ganz unähnlich dem niederländischen. Der Brite in den Kolonien war manchmal beliebt, zumeist aber respektiert. So korrupt die englische Gesellschaft im 18. Jahrhundert auch gewesen sein mag, 8)so unbestechlich und rechtlich denkend war sie im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Doch zu einer echten Synthese zwischen dem britischen Wesen und den Nieder- oder auch Hochkulturen der Übersee kam es so gut wie nie. Die Parade der indischen Armee und die Haltung der Offiziere am „Tag der Republik“ (26. Jänner) in Delhi erinnern zwar sehr lebhaft an britische Vorbilder; da glaubt man Sahibs aus Sandhurst mit bräunlicher Hautfarbe vor sich zu sehen, und natürlich hat die englische Sprache im jetzigen „Commonwealth“ sich einen Platz gesichert, den unmoderne oder primitive Idiome ihr nicht streitig machen können, aber man vergesse da nicht die britische „Kälte“ (die oft nichts als Gehemmtheit ist), wie auch das Gefühl einer kollektiven Überlegenheit. Die englische Religion ist eben die anglikanische, und die ist nun einmal auf die Länder der englischen Zunge zugeschnitten. Sie ist nicht universell; sie hat keine Weltreligion produziert. Von einem Mahratten oder Masai zu erwarten, er solle sich dem Idearium von Heinrich VIII., John Knox, Cranmer, Jakob I. und John Locke verschreiben, ist zu viel verlangt. Der katholische Glaube konnte hingegen alle möglichen und unmöglichen Synthesen mit heimischen Kulturen eingehen. Ein Bewohner der Elfenbeinküste mag sich als Franzose fühlen und in Paris sich als Gleicher unter Gleichen bewegen, als copin , aber ein Ibo oder ein Yoruba wird nie auch nur annähernd ein englischer Gentleman werden. Doch waren die Kolonien und auch die Dominions 9)für die Engländer ein großer „Atemraum“. Dabei aber erlosch das kleine Engländertum der Little Englander nie ganz. Eine typische Britin der gehobenen Schichten, die in Indien schwanger wurde, fuhr nach England zurück, um dort niederzukommen, denn einesteils fühlte sie doch den Einfluß des ius soli , andernteils 10)war es für ihr Kind „peinlich“, später im Leben bei allen möglichen amtlichen oder gesellschaftlichen Anlässen eingestehen zu müssen, nicht in York, in Devonshire oder in Camden House, sondern in Seconderabad, Bangalore oder in Mahabalipuram auf die Welt gekommen zu sein.
Doch das weltweite britische Lebensgefühl zeigte gerade durch diese Beschränkungen, daß man sich dem Kontinent gegenüber stets sehr unsicher fühlte. Am Kontinent gab es zwar die Anglomanie mit allen ihren Facetten; da gab es eine aristokratische, sozialistische, bürgerliche, „protestantische“ Anglomanie, aber auch eine Anglomanie der Katholiken, Juden, Herrenmodeverkäufer, Techniker, Feministinnen, Homosexuellen, Seeleute, Pferdezüchter, Sportler aller Art und der Globetrotter, eine Besessenheit, die heute weitgehend verblaßt ist, doch einst ungeheuer stark war. 11)Es gab auch in England einige wenige Schwärmer für den Kontinent – vor allem die großen Nonkonformisten, die von der Gesellschaft angewidert, entfremdet oder abgelehnt am Kontinent lebten (und starben), Männer, und Frauen wie Byron, Shelley, Keats, Kemble, Wilde, D. H. Lawrence, Nancy Mitford, W. H. Auden u.a. mehr. Doch das waren immer Ausnahmen. Es gibt auch heute Engländer, die prinzipiell nicht den Kontinent besuchen, denn dark men begin at Calais , „dunkelhäutige Menschen beginnen in Calais“, was einfach bedeutet, daß Afro-Asien gleich auf der anderen Seite des Kanals seinen Anfang nimmt. Das aber wiederum beleuchtet einen weiteren Aspekt des britisch-kontinentalen Verhältnisses: Wenn der Kontinent „afro-asiatisch“ ist, dann sind die Briten die einzig wirklich weißen Leute, die einzigen wirklichen Europäer. Und das läßt sich wieder umkehren: Europa ist der „farbige“ Kontinent und die Briten sind dann etwas ganz Besonderes. So sagt der durchschnittliche Engländer, daß er im Sommer den Kontinent besuchen würde, doch gibt es eine Minderheit, die umschweifelos erklärt: „This summer we’re going to Europe.“ 12)Und tatsächlich bildet England zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada einen ganz besonderen und gesonderten Teil der westlichen Welt, des „Abendlands“. 13)
Somit betritt der Brite den Kontinent mit buchstäblich ‚gemischten‘ Gefühlen. Er ist dann ‚ganz wo anders‘. 14)Er fühlt sich dann nur zu oft moralisch überlegen aber intellektuell unterlegen. Er ist in Wirklichkeit weder das eine noch das andere, doch muß man einräumen, daß die oberen Mittelschichten bei uns eine viel bessere Allgemeinbildung genossen haben, 15)und der Südeuropäer zwar nicht besser, aber schneller denkt, was tatsächlich rassisch-biologisch-nervlich bedingt ist. (Er ist auch der schnellere und gewandtere Autofahrer.) 16)Doch fühlt sich der Engländer bei uns unsicher, weil er die Reaktionen des Kontinentaleuropäers nicht voraussehen kann, und diese Voraussicht allein schafft Vertrauen. 17)Sprachlich ist er auch deswegen gefesselt, weil es ihm seine Hemmungen oft nicht erlauben, sich in einer Sprache auszudrücken, von der er weiß, daß er sie nicht gut beherrscht und er sich lächerlich machen könnte. (Abgesehen davon lernt er fremde Sprachen nicht gern, denn schon ein altes englisches Sprichwort sagt: He who speaks two languages is a rascal .) In diesem Überlegenheits-Unterlegenheitsdilemma liegt eine große politische, besser gesagt, außenpolitische Schwäche, die wir auch mutatis mutandis beim Amerikaner finden, der auf der nordamerikanischen, von drei Ozeanen und zwei großen Meeren umspülten, Großinsel lebt.
Doch in einem gewissen Moment „abdiziert“ auch der sich sehr anderen Völkern überlegen fühlende Brite, und er sagt sich dann streng und nüchtern, daß er von seinem Piedestal herabsteigen muß. Der Ausländer, the alien , 18)kann in Wirklichkeit nicht wirklich minderwertig sein; er ist im Grunde ein genau so edler, kluger und anständiger Mensch wie der Brite und sollte als solcher behandelt werden, sollte auch für dieselben gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen „reif“ sein. Das ist natürlich so formuliert ein Unsinn. Der alien ist aus einer Reihe von Ursachen nun einmal wirklich ein anderer Mensch, und in der britischen Außenpolitik hat dieser Dualismus, dieses jähe Umkippen von einem Unsinn zum anderen, schwere Enttäuschungen und Niederlagen hervorgerufen. Doch aus zerstörten Illusionen lernen manchmal Einzelne, Völker aber nie .
Читать дальше