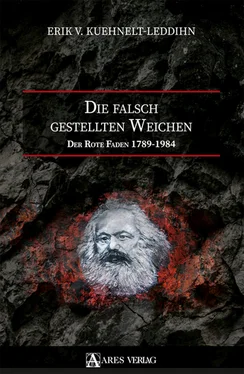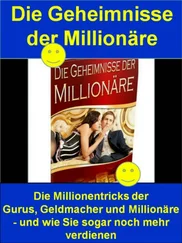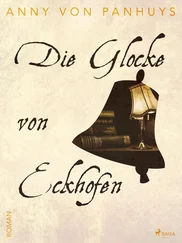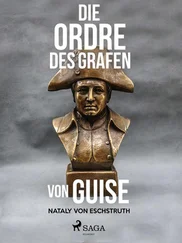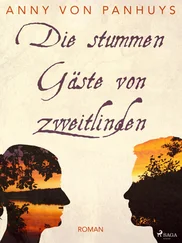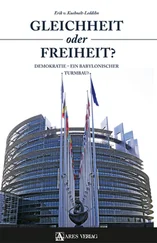Man darf nicht vergessen, daß zum Beispiel ein Ungar einem Land angehörte, das 896 gegründet wurde und seit 1001 ein Königreich war, ein Land mit Grenzen, die Élisée Reclus, der große französische Geograph, für die idealsten Europas hielt. Die heilige Wenzelskrone, die Böhmen, Mähren und Schlesien verband, ging ins 10. Jahrhundert zurück. Kroatien mit Dalmatien und zum Teil mit Bosnien war einer der ältesten Staaten Europas. Auch das nunmehr geteilte Polen existierte schon im 10. Jahrhundert – von der Republik Ragusa ganz zu schweigen. 10)Im Vergleich zu diesen uralten Staatswesen war selbst das alpine Österreich ein historisches Flickwerk, recht neu, ein Land das erst im 14. Jahrhundert Tirol einverleibt hatte und Salzburg gar erst mehr als 400 Jahre nach dem friedlichen Anschluß von Triest. (Ohne Habsburg hätte Österreich zweifellos nicht über das Salzkammergut hinausgereicht!) Allerdings waren Triest, die Küstenlande und was heute Slowenien genannt wird alte habsburgische Erblande. Der böl mische König war Kurfürst des Römisch-Deutschen Reiches, der österreichische Erzherzog war es nicht. Zudem war der österreichische Erzherzogstitel auf dem gefälschten Privilegium Maius gegründet. Die „Erblande“ waren Erbgut der schweizerischen, dann schweizerisch-lothringischen Habsburger, sicherlich das vornehmste und, sagen wir es ohne Zögern, das beste und humanste Herrschergeschlecht, das Europa je hervorgebracht hatte. Aber dennoch müssen wir hier die Frage stellen: Wie konnte man von einem Ungarn (gleichgültig ob er Magyare oder Nichtmagyare war), von einem Böhmen deutscher oder nichtdeutscher Zunge, von einem Dalmatiner kroatischer, italienischer oder serbischer Abstammung verlangen, sich als „Österreicher“ zu fühlen? Das war nicht nur für „national“, sondern auch für geschichtlich denkende Menschen nicht allzu leicht. Es war dies einfacher bei Soldaten oder bei Beamten, die einen Eid dem gemeinsamen Herrscher geleistet hatten und zu ihrem Monarchen in einer Art von Feudalverhältnis standen. Mit dem katholischen Klerus war das wieder anders: Dieser entstammte zumeist dem mittleren (zumal auch den unteren, bäuerlichen) Schichten, und da waren nationalistische Tendenzen nicht selten. Das war besonders dort der Fall, wo es keinen „nationalen“ Adel gab, wie zum Beispiel in der Slowakei und in Slowenien, 11)und der Klerus somit als Erster und Zweiter Stand auch eine politische Führerrolle innehatte. Auch gab es in der Monarchie einen besonders starken Nationalismus der nichtkatholischen Gebiete, wie in den reformierten Komitaten Ungarns, der lutherischen Nordwest-Slowakei, den Überresten der Reformation in Böhmen und Mähren, denn die Dynastie hatte schließlich die Gegenreformation „am Gewissen“.
Doch war die Lage innerhalb des Kaisertums Österreich insoweit noch komplizierter, als es ein flüchtiger Blick vermittelt, weil es innerhalb seiner historischen Kronländer ethnische Minderheiten gab, was sich gerade im Jahre 1848 explosiv auswirkte. Der Aufstand der „nationaldemokratischen“ Tschechen in Prag fand keinen Widerhall bei den Deutschböhmen und Deutschmährern. Der ungarische Aufstand fand Slowaken, Siebenbürger Rumänen, südungarische Serben und Kroaten auf der Seite der Habsburger und der Wiener Regierung…, nicht aber die große Mehrheit der ungarländischen Deutschen. 12)Es muß auch vermerkt werden, daß bei den Aufständen der von Italienern besiedelten Provinzen Österreichs, der Lombardei und Venetiens, die Mehrzahl der Bauernschaft keine Begeisterung für das Risorgimento zeigte und wacker mit der kaiserlichen Armee kollaborierte. 13)Hinter dem Risorgimento standen Bürger, Intellektuelle und ein Teil des Adels. Nach dem Sturz der Bourbonenherrschaft im Königreich beider Sizilien war das einfache Volk ganz und gar nicht auf der Seite der „Befreier“. Jahrelang hatte die neue italienische Regierung gegen höchst populäre Banden von Aufständischen (die allesamt als Briganten hingestellt wurden) zu kämpfen. In den früheren österreichischen Provinzen, wie auch in der Toskana, wo Habsburger regierten, verschlechterte sich nach dem Risorgimento die Verwaltung zusehends. Bis zum heutigen Tag ist die österreichische Herrschaft selbst in Friaul in bester Erinnerung geblieben. 14)
Da aber in der Geschichte, besonders in der neueren Geschichte, die Politik in der Städten gemacht wird, ist die Stimmung in den Städten und ganz besonders in den Großstädten von ausschlaggebender Bedeutung. Die Revolutionen im Mittelalter kamen größtenteils vom Land. Nicht der Handwerker oder der Großbürger, sondern der Bauer revoltierte, obwohl auch da natürlich Ausnahmen zu vermerken sind. Der städtische Charakter der Revolutionen zeigte sich im Jahre 1848 mit großer Deutlichkeit.
Sezessionistisch-nationalistische Bewegungen gab es jedoch in den deutschen Landen nicht. Die „Nationale Frage“ drehte sich dort um das Problem Großdeutschland-Kleindeutschland. Die Kleindeutsche Lösung, die 1871 verwirklicht wurde, war die Errichtung eines (Zweiten) Deutschen Reiches unter preußischer Führung. Echt konservative Elemente lehnten dies ab. Selbst ein preußischer König wie Friedrich Wilhelm IV., der „Romantiker auf dem Königsthron“, der sich geweigert hatte, die Krone aus der Hand der Bundesversammlung, „aus der Gosse“, anzunehmen (wie zum Beispiel Louis-Philippe, der sich vom Parlament hatte wählen lassen), erklärte rundweg, daß er doch nicht deutscher Kaiser werden könnte, solange ein Kaiser in Wien residiere. 15)Und es war natürlich selbstverständlich, daß die gemäßigte Linke nach Berlin blickte, wie es ja auch seinerzeit die Französischen Revolutionäre getan hatten, denn Berlin, so anders als Wien, war doch ein Hort des Fortschritts. 16)Die extreme Linke träumte natürlich von einem zentralistischen Deutschland, in dem die Fürstentümer den Weg allen Fleisches gegangen waren. Diese wären ohne Zweifel ein großes Hindernis auf dem Wege zu einer engmaschigen deutschen Einheit gewesen und hatten doch dauernd mit Reichsfeinden paktiert (die Preußen ganz obenauf!), aber was wäre Deutschland (auch heute) ohne diese separatistischföderale Entwicklung gewesen und geworden, und dasselbe kann man auch von Italien sagen. Heute gibt es in Frankreich kaum ein Geistes- oder Kulturleben von Bedeutung außerhalb von Paris, in England außerhalb von London. 17)Es versteht sich jedoch von selbst, daß die katholischen Länder des Deutschen Bundes ein Großdeutschland anstrebten, in dem das katholische Element das Übergewicht gehabt hätte. Doch gab es auch konservative Elemente im evangelischen Deutschland, die für Wien und gegen Berlin waren; die gab es selbst in Preußen. 18)
Die Revolution in Böhmen wurde mit Leichtigkeit, die in Berlin unschwer, die in Wien schon schwerer, die in Italien mit Erfolg kriegerisch bekämpft, denn da gab es eine bewaffnete Intervention vom Königreich Sardinien. 19)Die größte Gefahr für das österreichische Kaisertum kam jedoch von Ungarn. Hier rächte sich der imperiale Austriazismus am meisten. Obwohl auch diese Revolution einen gemäßigt linken Charakter hatte, war dort der hohe und niedere Adel in seiner überwiegenden Mehrheit auf der Seite der „Aufständischen“. Die Ursache dieser Revolution war staatsrechtlichen Charakters. Der Wiener Zentralismus, der auf die Aufklärung und den überaus fortschrittlichen Joseph II. 20)zurückging, war stets bestrebt, die ungarische Autonomie zu beschneiden. Nun hatte Wien auf eine ultimative Aufforderung des ungarischen Reichstags hin beschlossen, dem Land eine weitgehende Selbstverwaltung zu geben. Der Kaiser und König Ferdinand hatte dazu Ja und Amen gesagt. Das aber wollten die im ungarischen Staatsverband lebenden Kroaten nicht und rebellierten unter der Führung ihres Banus Jellačić. Das gab dem Wiener Hof wieder den Mut, die Zusage rückgängig zu machen, was aber einem Wortbruch des Monarchen gleichkam. Um der strafferen, magyarischen Herrschaft zu entkommen – die lateinische Amtssprache war 1844 durch die magyarische ersetzt worden –, fingen Ungarns Nationalitäten an, sich mit Wien gegen Pest zu verbünden. Die Einheit Ungarns war nun durch Wien bedroht, es folgten eine Unabhängigkeitserklärung und ein Sezessionskrieg, mit denen die österreichische Armee, die zugleich in Böhmen, Wien und Italien beschäftigt war (auch in Galizien gab es Unruhen), nicht fertig werden konnte. Prinz Alfred zu Windisch-Grätz 21)wurde nach etlichen Siegen und Niederlagen durch den Freiherrn von Weiden, dieser wiederum nach dem Verlust von Ofen (Buda) durch Haynau ersetzt, ein natürlicher Sohn des Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen. Haynau siegte im Westen Ungarns, die Russen fürchteten einen Parallelaufstand in Kongreßpolen und kamen deshalb Wien zu Hilfe, und ihnen ergab sich dann die ungarische Armee. Ungarn wurde dann fast 18 Jahre hindurch diktatorisch von Wien aus verwaltet – bis es 1867 zum „Ausgleich“ kam. Damals also wurde die „Österreich–Ungarische Monarchie“ geboren. Das einigende Band der beiden Länder wurden die Dynastie, die Armee, die gemeinsame Außenpolitik, die Zollunion, die Notenbank und (später) die gemeinsame Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina.
Читать дальше