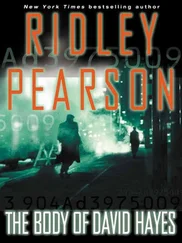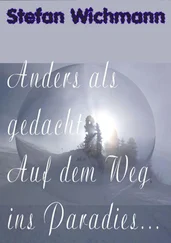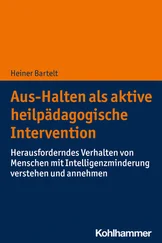Diese Intensivierung entsteht häufig im Rahmen von Grübel- und Sorgenprozessen. Menschen suchen ständig nach neuen Formulierungen für die Vergangenheit, um damit zukünftige Ereignisse besser zu steuern. Dabei stellen sie sich zukünftige Ereignisse viel schlimmer und schwieriger vor, als sie jemals eintreten. Sie treten in eine Situation mit A < B < C ein. Dann ist die Gegenwart schlecht und die Zukunft noch schlimmer.
2.2.2 Symbolische Generalisierung von Vermeidung
An dem Beispiel mit dem Mädchen, das Angst vor Katzen hat, ist auch noch folgender Aspekt spannend: Es hat nicht nur Angst, sondern es flüchtet auch. Das Mädchen reagiert nicht nur ausgeprägt emotional auf Katzen oder symbolische Stimuli, die sich auf Katzen beziehen, es entzieht sich ihnen bewusst und vermeidet sie. Die meisten Lebewesen ziehen sich in solchen Situationen instinktiv zurück und lernen, der Quelle des Schmerzes aus dem Weg zu gehen. Kühe meiden elektrische Zäune, Menschen haben Respekt vor heißen Öfen. Alle Lebewesen vermeiden oder fliehen vor Schmerz, wann immer es möglich ist. Es ist daher folgerichtig, dass sich Lebewesen, die der Sprache mächtig sind, auch von symbolischen Stimuli fernhalten, die die Funktion eines Auslösers schmerzhafter Empfindungen oder Emotionen übernommen haben.
Diese Annahme wurde in Studien der Relational Frame Theory überprüft. So trainierten Dymond, Roche, Forsyth, Whelan und Rhoden (2007) Teilnehmer in einem Experiment. Sie sollten zunächst gemäß eines relationalen Netzwerkes A = B = C reagieren, in dem A und C implizit miteinander in Beziehung stehen (Combinatorial Entailment). Anschließend wurde der Stimulus A durch respondentes Lernen mit einem furchterregenden Bild und Geräusch assoziiert. Jedes Mal, wenn A auf dem Bildschirm erschien, folgten das furchterregende Bild und das Geräusch. Nachdem diese Verbindungen erlernt worden waren, konnten die Probanden durch das Drücken der Leertaste das furchterregende Bild und das Geräusch vermeiden. Wie vermutet lernten sie schnell, bei Erscheinen des Stimulus A durch ein Drücken der Leertaste das Erscheinen von Bild und Geräusch zu unterbinden. Zusätzlich erlangte B, das während der relationalen Lernphase in direkter Beziehung zu A stand, die Funktion von A, d. h. B kündigte ebenfalls Angst an. Außerdem erlangte C, das nie gemeinsam mit A präsentiert wurde, sondern nur in indirekter, impliziter Beziehung zu A stand, dieselbe Funktion. Im Ergebnis drückten die Probanden die Leertaste auch dann, wenn sie C auf dem Bildschirm sahen. Das Vermeidungsverhalten generalisierte also durch Sprache.
Dies entspricht dem Ereignis, bei dem das Mädchen wegläuft, als der Junge Katzen erwähnt. Rufen Sie sich in Erinnerung: Die reale Katze, die das Mädchen kratzt, erlangt ihre furchtauslösende Funktion durch respondentes Lernen (direkte Assoziation zwischen Katze und Kratzen). Katzen im Allgemeinen erlangen ihre Funktion durch den üblichen Prozess der Generalisierung (auf der Grundlage ihres ähnlichen Aussehens). Das Wort »Katze« erlangt seine Funktion allerdings durch seine symbolische Beziehung zu tatsächlichen Katzen. Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum unser Patient, der an einer Zwangsstörung leidet, aufhört in seinem Chemiebuch zu lesen, wenn er »H 2O« liest (  Kap. 1). Die Äquivalenzbeziehung zwischen Wasser und H 2O transformiert die Funktion von H 2O. Die Kombination von Buchstaben und einer Zahl löst dann Angst aus. Sie erinnert den Patienten daran, dass Wasser Cholera übertragen kann. Unsere Patientin, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, zeigt ein ähnliches Vermeidungsverhalten, wenn sexuelle Gewalt, deren Opfer sie geworden war, erwähnt wird. Sie hört auf zu sprechen, wendet den Blick ab oder wechselt das Gesprächsthema. Sie vermeidet Fernsehsendungen, die einen Bezug zu dem haben, was ihr widerfahren ist. Gespräche mit Freundinnen sind dadurch eingeschränkt. Sie vermeidet, Worte zu hören, die mit ihrem Leid in Beziehung stehen.
Kap. 1). Die Äquivalenzbeziehung zwischen Wasser und H 2O transformiert die Funktion von H 2O. Die Kombination von Buchstaben und einer Zahl löst dann Angst aus. Sie erinnert den Patienten daran, dass Wasser Cholera übertragen kann. Unsere Patientin, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, zeigt ein ähnliches Vermeidungsverhalten, wenn sexuelle Gewalt, deren Opfer sie geworden war, erwähnt wird. Sie hört auf zu sprechen, wendet den Blick ab oder wechselt das Gesprächsthema. Sie vermeidet Fernsehsendungen, die einen Bezug zu dem haben, was ihr widerfahren ist. Gespräche mit Freundinnen sind dadurch eingeschränkt. Sie vermeidet, Worte zu hören, die mit ihrem Leid in Beziehung stehen.
In allen geschilderten Fällen ist die Bandbreite möglicher Verhaltensweisen, die den Betroffenen zur Verfügung stehen, deutlich eingeengt. Dies geschieht durch einen symbolischen Stimulus, der über Verknüpfungen schmerzhafte Emotionen auslöst. Während das kleine Mädchen ein paar Sekunden vorher lustig über alles spricht, verringert das Hören des Wortes »Katze« unmittelbar ihren Handlungsspielraum. Es ist, als ob ein Alarmsignal ihr nahelegt, alles fallen zu lassen und möglichst schnell zum Notausgang zu rennen. Vergleichbar ergeht es den Patienten, die bei Konfrontation mit dem Wort »Wasser« oder »sexuelle Gewalt« aufhören zu lesen, nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr sprechen oder keine Videos mehr ansehen.
2.2.3 Hilfreiche versus problematische Vermeidung
Symbolische Stimuli schränken das Verhaltensrepertoire ein. Das ist in vielen Fällen vollkommen angemessen. Wettervorhersagen, die Anwohner dazu aufrufen, ihr Haus während eines Sturmes nicht zu verlassen, sind nützlich, wenn Sie in einer Region leben, in der Wirbelstürme häufig vorkommen. Das Beachten dieser Hinweise verringert die Handlungsmöglichkeiten: Die Betroffenen können sich nicht mehr uneingeschränkt frei bewegen. Trotzdem ist es eine weise Entscheidung, bei Sturmwarnung zu Hause zu bleiben. Hier ist symbolische Kontrolle vorteilhaft, weil sie Unheil verhindert. Manchmal kann Sprache Menschen überlisten und sie dazu bringen, harmlose (oder gar vorteilhafte) Stimuli zu vermeiden. Das bringt sie dann von einem vorteilhafteren Weg ab.
Betrachten Sie folgendes Beispiel: Sie wandern in einem Wald und beschließen nach einigen Stunden, den Heimweg anzutreten. Unglücklicherweise verirren Sie sich. Als Sie auf eine Kreuzung treffen, finden Sie keinen Wegweiser, der anzeigt, welcher der drei Wege zurück zu Ihrem Auto führt. Sie entscheiden sich rein zufällig für einen Weg und hoffen, dass er Sie sicher zu Ihrem Auto führen wird. Sie nehmen den Weg nach links, aber nach 10 Minuten geraten Sie in einen Sumpf und sinken tief ein. Glücklicherweise können Sie nach Ästen greifen und sich herausziehen. Bei ihrer Rückkehr zur Kreuzung treffen Sie auf einen anderen Wanderer, der sich ebenfalls verlaufen hat. Natürlich erzählen Sie ihm sofort, dass er den linken Weg nicht einschlagen soll, damit er nicht auch in den Sumpf gerät.
Lassen Sie uns an dieser Stelle innehalten und analysieren, was bisher geschehen ist. Sie haben die Folgen Ihres Handelns durch direkte Exposition erfahren (Sie folgten dem linken Pfad und gerieten in einen Sumpf). Der andere Wanderer erlernt diese Konsequenz durch Sprache (er hört: »Wenn Sie diesem Pfad folgen, werden Sie in einen Sumpf geraten.«). Sie beide werden in Zukunft den linken Pfad meiden. Ihre Vermeidung ist das Ergebnis von direktem Lernen, während seine Vermeidung auf relationalem Lernen beruht (die symbolische, wenn-dann-Beziehung zwischen dem linken Pfad und dem Hineinfallen in den Sumpf).
Fahren wir mit dem Beispiel fort: Sie erzählen dem anderen Wanderer, dass Sie Ihren Weg zurück zu Ihrem Auto suchen. Er sagt Ihnen dann, dass er weiß, wo der Parkplatz ist. Er bietet Ihnen an, Sie dorthin zu bringen. Sie folgen ihm entlang des Hauptweges, anstatt den rechten oder linken Weg zu nehmen. Nun ist es an Ihnen, durch Sprache zu lernen, und die direkte Erfahrung des anderen Wanderers zu nutzen. Sie wandern weitere Stunden und erreichen endlich den Eingang zum Wald. Es ist spät und wird schon dunkel. Ihr Begleiter läuft zu seinem Wagen, erleichtert darüber, dass er nach dem langen Ausflug endlich am Ziel ist. Aber trotz der schwachen Beleuchtung erkennen Sie sofort, dass dies nicht der Eingang ist, an dem Ihr Auto steht. Der andere Wanderer hat Sie zu dem Eingang im Osten gebracht, an dem er sein Auto geparkt hatte und nicht zum Zugang im Norden, an dem Ihr Auto steht. Es stellt sich heraus, dass Sie den Weg nach rechts hätten nehmen müssen, um zu Ihrem Wagen zu gelangen. Jetzt wäre ein sehr langer Marsch nötig, um nach Hause zu gelangen. (Sie sollten lieber den anderen Wanderer bitten, Sie im Auto mitzunehmen!).
Читать дальше
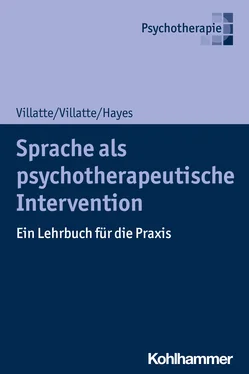
 Kap. 1). Die Äquivalenzbeziehung zwischen Wasser und H 2O transformiert die Funktion von H 2O. Die Kombination von Buchstaben und einer Zahl löst dann Angst aus. Sie erinnert den Patienten daran, dass Wasser Cholera übertragen kann. Unsere Patientin, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, zeigt ein ähnliches Vermeidungsverhalten, wenn sexuelle Gewalt, deren Opfer sie geworden war, erwähnt wird. Sie hört auf zu sprechen, wendet den Blick ab oder wechselt das Gesprächsthema. Sie vermeidet Fernsehsendungen, die einen Bezug zu dem haben, was ihr widerfahren ist. Gespräche mit Freundinnen sind dadurch eingeschränkt. Sie vermeidet, Worte zu hören, die mit ihrem Leid in Beziehung stehen.
Kap. 1). Die Äquivalenzbeziehung zwischen Wasser und H 2O transformiert die Funktion von H 2O. Die Kombination von Buchstaben und einer Zahl löst dann Angst aus. Sie erinnert den Patienten daran, dass Wasser Cholera übertragen kann. Unsere Patientin, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, zeigt ein ähnliches Vermeidungsverhalten, wenn sexuelle Gewalt, deren Opfer sie geworden war, erwähnt wird. Sie hört auf zu sprechen, wendet den Blick ab oder wechselt das Gesprächsthema. Sie vermeidet Fernsehsendungen, die einen Bezug zu dem haben, was ihr widerfahren ist. Gespräche mit Freundinnen sind dadurch eingeschränkt. Sie vermeidet, Worte zu hören, die mit ihrem Leid in Beziehung stehen.