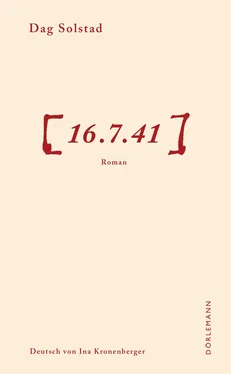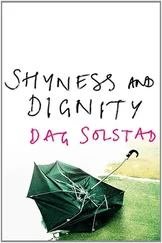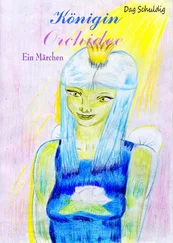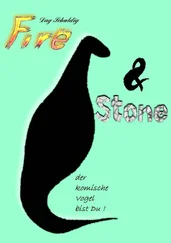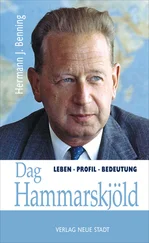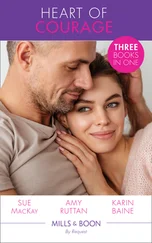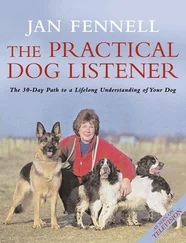Dag Solstad - 16.7.41
Здесь есть возможность читать онлайн «Dag Solstad - 16.7.41» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:16.7.41
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
16.7.41: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «16.7.41»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
2001 wohnt Dag Solstad in einer Wohnung am Maybachufer 8 in Berlin. Auf Streifzügen durch die Berliner Straßen lässt sich auch der Autor Dag Solstad zunehmend einkreisen. Hier finden sich Momente des Glücks und der Ruhe, aber auch der Angst und der Verzweiflung. Der Roman führt uns weiter nach Lillehammer und in sein Elternhaus in Sandefjord.
16.7.41 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «16.7.41», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Oder er ermöglichte mir, Dinge wie diese zu schreiben: »Derjenige, der das hier schreibt, weiß, dass ich vor mehr als zehn Jahren mit diesem Flugzeug geflogen bin, und ich weiß im Moment des Schreibens, wie die Reise verlief. Doch derjenige, der vor der Departure-Anzeigetafel des längst stillgelegten Flughafens Fornebu steht und nichts weniger ist als ›ich‹, ist auf seiner Reise noch nicht weitergekommen als bis zu dieser Tafel, vor der er steht, um die Flugnummer, das Gate und die Boardingzeit herauszusuchen, und er hat viel Zeit vor sich, die noch nicht gefüllt ist und über die er noch nichts weiß, obgleich wir beide ›ich‹ sind, das schreibende Ich wie auch das Ich, über das ich schreibe. Wir sind beide ich und nennen uns ich und können jedes Mal, wenn einer von uns etwas denkt, ›dachte ich‹ oder ›sagte ich‹ oder ›fragte ich mich‹ sagen, und doch trennen uns gut zehn Jahre, und ich, der das hier schreibt, weiß viel mehr über ihn, der beschrieben wird, als er selbst, und auch viel mehr über ihn als über mich selbst und meine Zukunft, über die ich gar nichts weiß, weil sie vor mir liegt und nicht geschaut werden kann, und doch sind wir beide, sowohl ich mit einer Zukunft, die ich mir nicht vorstellen kann, als auch er, über den ich schreibe, ausgestattet mit dem Wort ›ich‹, dem einzigen existierenden Wort, das ausschließlich mir vorbehalten ist. Das Wort ist Ur. Die verrinnende Zeit.«
Wie man sieht, habe ich versucht, einen Einstieg hinzubekommen, der die Auflösung der Identität in der Begegnung mit der Zeit einbezieht. Es ist also eine Art düsteres Spiel, mit dem ich meinen neuen Roman ursprünglich beginnen wollte. Dass es sich eindeutig um meine eigene Identität gehandelt hat, hat mich vermutlich ebenfalls angespornt. »Wie immer bin ich derjenige, der das hier schreibt.« Wie immer war ich derjenige, der das hier schrieb: »Zu Beginn dieser Geschichte ist Bjørn Hansen gerade fünfzig geworden und steht am Bahnhof von Kongsberg«, wie es zu Beginn von Elfter Roman, achtzehntes Buch heißt, dem nächsten Buch, das der Ich-Erzähler aus der Eröffnungsszene dieser Geschichte schreiben wird und von dem er noch nichts ahnt, das jedoch von mir geschrieben wurde, so wie stets ich derjenige bin, der das hier schreibt, und darauf verweise ich mit dem zunehmenden Verdacht, dass dieses »Ich« kein Ich ist, sondern etwas anderes, etwas, das sich auflöst, wenn man anfängt, es näher zu untersuchen, z.B. in einer Art Spiel mit Wort und Zeit, doch auch in dieser Auflösung bin immer ich derjenige, der das hier schreibt. Das scheint mich sehr zu beschäftigen, da ich darauf poche, meinen neuen Roman mit diesem Spiel zu beginnen, während ich nun also fliegen will.
Dennoch habe ich diesen Beginn verworfen. Warum habe ich ihn verworfen? Es war ein langer Prozess, der erst endgültig abgeschlossen war, als ich mich beiseitenahm und mich eindringlich mit Du ansprach, um etwas Distanz in die Sache zu bringen. Jetzt schreibst Du schon, sagte ich zu mir selbst, seit mehr als fünfunddreißig Jahren Bücher, warum hast Du das hier nicht zu einem früheren Zeitpunkt aufgegriffen? Dafür hättest Du jahrelang Zeit gehabt und auch die Gelegenheit, es zu machen, aber das hast Du nicht getan. Du magst sagen, es ist ein Versäumnis, und es bedauern, aber das nützt mir nichts. Ich will jetzt fliegen und mich nicht mit Deinen Versäumnissen in einem Zeitraum von fünfunddreißig Jahren gelebten Lebens beschäftigen. Es ist jetzt zu spät, um mit einem »Wie immer bin ich derjenige, der das hier schreibt« anzukommen. Die Zeit ist Dir davongelaufen. Dass man begreift, in welcher Phase des eigenen Lebens man sich befindet, ist unabdingbare Voraussetzung für das beanspruchte Privileg, sich in fiktiver Form an die Öffentlichkeit zu wenden. Ich befinde mich in einer Phase, in der es zu spät ist, um dieses düstere Spiel mit Wort und Zeit mit mir selbst als Objekt oder Opfer anzustellen. Mich beschäftigt die Zeit, aber nicht in dieser aufgelösten Form. Meine Auflösung ist eine andere, ihr muss ich mich zuwenden. Dass mich dieses Spiel noch immer fasziniert, muss man als etwas Bedauernswertes hinnehmen, das keinerlei Legitimität verleiht, es in einen Romananfang zu pressen, wenn ich gerade fliegen will.
Darum verwarf ich diesen Einstieg. Hoffentlich war es der glückliche Ausgang eines schwierigen Prozesses. Endlich davon befreit, kam mir jedoch eine Idee. Wie wäre es, wenn ich diesen Roman mit Fußnoten ausstatten würde? Dann könnte ich derlei Betrachtungen mit einbeziehen, die ich dem Leser soeben präsentiert habe. Gesagt, getan. Ich beschloss, diesen Roman mit Fußnoten auszustatten, wo immer es mir in den Sinn kommen sollte.
Fußnote 2.
Ursprünglich hatte ich hier einen langen Vortrag stehen, in dem ich mich an diesem Oktobertag vor mehr als zehn Jahren von außen schildere. Unter anderem meine Kleidung, und ich hielt mich besonders lange bei der Frage auf, ob ich einen Anzug trug oder nicht, und wenn ja, welchen Anzug: »Trug ich einen Anzug? Ich nehme es an, da ich nur Handgepäck dabeihatte, weshalb ich den Anzug am Leib trug, damit er nicht im Koffer zerknittert wurde. Und ich wäre kaum ohne Anzug verreist, da ich an einer Literaturveranstaltung in Frankfurt teilnehmen wollte. Daher hatte ich ihn sicherlich an. Ich besaß damals zwei Anzüge, einen beigefarbenen Anzug von Pierre Cardin und einen koksgrauen von Dior, beide in der Ciudad de Mexico erstanden, den ersten 1983, den zweiten in derselben Stadt 1986. Der Pierre-Cardin-Anzug dürfte ein wenig in die Jahre gekommen sein, etwas abgetragen und ganz sicher unmodern hinsichtlich Schnitt und dergleichen, aber das störte mich vermutlich kaum, weshalb ich ihn gut und gern getragen haben könnte, falls er keine Flecken hatte. Ja, ich glaube schon, dass ich ihn dem Dior-Anzug vorgezogen hatte, denn der Dior-Anzug hatte einen Makel. Er war zu eng, ich hatte ihn leider zu eng gekauft. Das hatte zur Folge, dass er nicht sehr angenehm zu tragen war, und außerdem war er an den Armen zu kurz, sodass die weißen Hemdsärmel mehr zu sehen waren, als es sich schickte. Ich könnte ihn trotzdem getragen haben, denn ich trug ihn oft bei großen Anlässen, wie die Mitwirkung an einer Literaturveranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse einer war. Aber ich glaube, ich hatte den Pierre-Cardin-Anzug dabei, so groß war die Veranstaltung nun auch wieder nicht.« Kurz zuvor hatte ich mich übrigens gefragt, ob ich einen Mantel trug, und angenommen, dass ich einen Frühlingsmantel übergezogen hatte, obwohl auch dieser nicht ohne Fehler war, die Gürtelschlaufe war abgerissen und nicht mehr angenäht worden. Desgleichen die Schuhe, es waren ziemlich ungeputzte schwarze Schuhe, hinten plattgetreten. Kurzum, ich konfrontiere die Leser mit einem reichlich schäbig aussehenden Mann. Mit teuren, aber abgetragenen und ziemlich unordentlichen Kleidern am Leib. Und ich selbst schildere mich vor zehn Jahren. Ich schreibe also über mich und wie ich vor zehn Jahren aussah. Ich, der ich bisher nie Wert darauf gelegt habe, die Kleider und das Aussehen meiner Romanfiguren zu beschreiben. Warum sollte ich es jetzt tun? Das habe ich zu beantworten versucht, wie ich sehe: »Warum ich dies jetzt tue, erschließt sich mir nicht ganz, vielleicht weil es eine besondere Begebenheit ist, dass ich in einem Roman mitwirken soll, als Hauptfigur, ich kann nicht sagen, dass ich davon geträumt habe oder mich besonders darüber freue. Aber es muss sein, es lässt sich nicht vermeiden.« Dann geschah jedoch Folgendes: Je mehr ich mich damit amüsierte, mich an diese alten Klamotten zu erinnern, und ich die Hauptfigur des Romans, also mich, darin kleidete, umso größer wurde mein Unbehagen. Dass ich mich, denselben und doch nicht denselben, von außen so detailliert beschrieb, fühlte sich mit der Zeit literarisch unerträglich an. Es wurde auch nicht besser, als ich dazu überging, Gegenstände zu beschreiben, die ich bei mir oder an mir trug, indem ich beispielsweise fragte, ob ich etwas am Handgelenk hatte, und darauf antwortete, ich trüge »eine billige Armbanduhr« am Handgelenk, um anschließend zu erzählen, dass ich eine unvorteilhafte Brille auf der Nase hatte, »eine sogenannte Hornbrille«, bevor ich mich zuletzt daran erinnerte, dass ich auch damals schon einen Bart trug. Doch jetzt reichte es mir. Jetzt war mein Unbehagen so angewachsen, dass mich allein der Gedanke daran, dass ich damals im Gegensatz zu heute einen Bart trug und ich mich wieder mit einem Bart ausstatten müsste, einem Bart, den ich mir bekanntlich irgendwann im Jahr 1991 abrasiert hatte und nie mehr wachsen ließ, mit einem Gefühl von Übelkeit erfüllte, weshalb ich mich weigerte fortzufahren, und ich löschte die Seiten, die ich bereits verfasst hatte. Es war mir schlicht und einfach unerträglich, so zu schreiben.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «16.7.41»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «16.7.41» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «16.7.41» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.