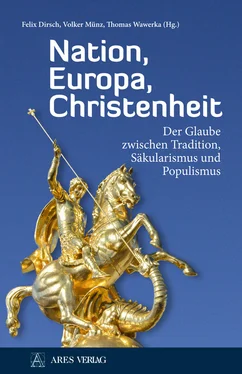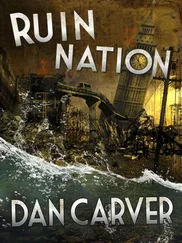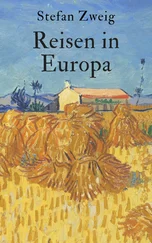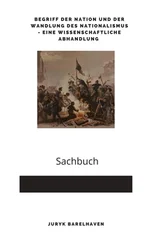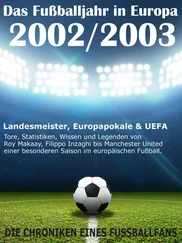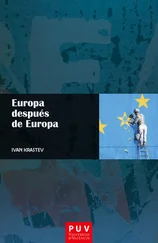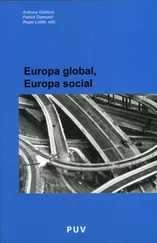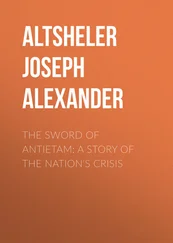Nur am Rande zu erwähnen ist, dass Visionäre durchaus schon vor längerer Zeit den Schulterschluss des katholischen Kirchenoberhauptes mit EU-Kommissaren und Nichtregierungsorganisationen prophezeit haben. Zu erinnern ist an den im Original Mitte der 1990er-Jahre auf den Markt gekommenen, leider zu wenig rezipierten Roman „Der letzte Papst“ von Malachi Martin SJ (1921–1999). 28 Der Autor, ein Geistlicher und zeitweiliges Mitglied der Gesellschaft Jesu, beschreibt eine kriminelle Kardinalsclique, die am Stuhl des amtierenden Nachfolgers Petri (Papst Johannes Paul II.) sägt. Schließlich tritt das Kirchenoberhaupt zurück. Das Ziel dieser verweltlichten Kurienmitglieder, die überlieferte Glaubenslehre zu einem humanitären Weltethos umzufunktionieren, ist in der Erzählung offenkundig. Heute kann man einiges von diesem fiktionalen Szenario in der Realität wahrnehmen.
Man mag mit Recht einwenden, dass die (wenigstens lehramtliche) Kluft von Kirche und Moderne lange zurückliegt. Das Zweite Vaticanum war sichtlich um die Zuschüttung wenigstens der ärgsten Gräben bemüht. Heute sind selbst die meisten höheren Amtsträger – für den weitaus größten Teil der Laien gilt der Konformismus ohnehin – um starke Anpassung bemüht, ungeachtet des Ratschlages des heiligen Apostels Paulus: „Nolite confirmari huic saecolo.“
Gibt es Affinitäten zu den sogenannten Populisten in einigen Staaten Osteuropas? Hier stellen „Populisten“ nicht eine Minderheit dar, sondern sogar die Mehrheit. Jedenfalls regieren sie. Natürlich gibt es keine zwingenden Korrelationen von christlichen Traditionen und den politischen Vorstellungen der Regierungen in Budapest und Warschau. Eine solche Annahme wäre wohl in der Tat eine unzulässige Vereinnahmung religiöser Gedanken zugunsten politischer Zwecke.
In Erinnerung zu rufen ist, dass Viktor Orbán in einem ideengeschichtlichen Exkurs seiner viel beachteten Rede vor jungen Ungarn in Rumänien am 26. Juli 2014 eine „illiberale Demokratie“ der liberalen gegenüberstellte. 29 Konkret thematisierte er die tendenzielle Entmachtung des politischen Souveräns, des Volkes, in der liberalistischen Auslegung der Demokratie. Diese Variante offenbare Affinitäten zur Herrschaft mächtiger globaler Konzerne, Organisationen und deren Interessenvertretern in verschiedenen Regierungen. Besonders registrierte er die Einflüsse des „Open.Society“-Börsenspekulanten George Soros, der vor Interventionsversuchen in seinem Herkunftsland nicht zurückschrecke. Orbáns Vorwurf an die Repräsentanten der liberalen Demokratie lautete, wohl zugespitzt, aber im Kern zustimmungsfähig: Sie überhöhten ihr System und trügen die damit verbundenen prioritären Freiheitsrechte gleich einer Monstranz vor sich her, könnten diese aber immer weniger garantieren. Grund hierfür sei zuvörderst die Akzeptanz der Masseneinwanderung durch die dominanten Eliten. Die Schlussfolgerung angesichts dieser Lagebeurteilung lautete: „Die liberale Demokratie“, so Orbán, sei „nicht mehr in der Lage, die Würde der Menschen zu schützen, Freiheit zu schaffen, die körperliche Unversehrtheit zu gewährleisten bzw. die christliche Kultur aufrechtzuerhalten.“ Auch an anderer Stelle hat er seine Aversionen gegen eine rein liberale Ausdeutung der Demokratie ausgedrückt, so in der Ansprache zur Lage der Nation am 19. Februar 2018 in Budapest: „Sie wollen, dass wir […] die Politik übernehmen, die aus ihren eigenen Ländern Einwanderungsländer gemacht und dem Niedergang der christlichen Kultur und der Expansion des Islam den Weg geebnet hat. Sie wollen auch, dass wir […] Länder mit gemischter Bevölkerung werden.“ Der wahre Europäer „verteidigt solche veralteten, mittelalterlichen Konzepte wie Heimat und Region nicht“ 30 , so der Ministerpräsident, womit er den Standpunkt seiner Opponenten süffisant wiedergab. Diese beiden Schlüsselzitate liefern die Begründung dafür, warum er die Grundausrichtung der liberalen Demokratie im Widerspruch zu jener Spielart sieht, die er „christliche Demokratie“ nennt. Letztere korreliert Orbán zufolge in zentralen Punkten mit der „illiberalen Demokratie“. Natürlich ragen in den Reden Orbáns existenziell politische Akzente heraus; er will keine ideengeschichtlichen Traktate vorlegen. Dennoch lohnt ein Blick auf geistesgeschichtliche Traditionslinien, die durchaus für die praktische Politik relevant sein können.
Doch nicht nur in Reden führender Mitglieder der jetzigen ungarischen Regierung finden wir entsprechende Akzente. Schon die ungarische Verfassung von 2011 gibt die neue Grundausrichtung vor. In der Präambel heißt es: „Gott segne die Ungarn!“ Anhänger der linksliberalen Eliten, besonders in den Medien, schienen beim Blick auf dieses Gesetzeswerk wie vom Blitz getroffen. Im britischen „Guardian“ stellte ein Journalist fest, die Verfassung atme christlichen Geist und stelle einen neuen Wertekanon auf: 31 Familie, Nation, Treue, Glaube und Liebe stünden im Fokus. Familie und Nation würden als Fundamente des Zusammenlebens begriffen. Besonders stieß den Linksliberalen in Europa das Bekenntnis zum „heranwachsenden Leben“ auf, das „ab dem Zeitpunkt der Empfängnis zu schützen“ sei, weiter das Verständnis von Ehe als Verbindung von Mann und Frau. Hier zeigt sich ein offiziell abgesegneter und partiell ins Recht transformierter Wertekatalog, dessen Inhalte man in Mittel- und Westeuropa nicht selten mit der Gesinnung „rechter Christen“ identifiziert.
Weitere Überlegungen zu Orbáns oben erwähnten Ausführungen finden sich in seiner politischen Umgebung. So verwies György Schöpflin, zeitweise Mitglied im EU-Parlament und aktiv in der Regierungspartei Fidesz, auf einige kulturelle Bruchlinien in der EU. 32 Östliche Länder wie Ungarn seien lange Zeit Teile von Großimperien gewesen, welche die Modernisierung von Staat und Gesellschaft nicht selten unterdrückt hätten. Nach dem Niedergang dieser Mächte hätten autoritäre Lösungen oft als unvermeidlich gegolten. Diese kamen sowohl von nationalistischer Seite – das Regime des Reichsverwesers Miklós Horthy war eine Zeit lang mit dem Nationalsozialismus verbunden – wie auch von kommunistischer. Solche Formen von Kolonialisierung durch fremde Mächte, die bis 1989 das Schicksal Ungarns bestimmten, hinterließen Spuren im Geschichtsgedächtnis dieser Nation. Viele Bewohner haben noch die Unterdrückung erlebt oder kennen sie zumindest vom Hörensagen. Sie sind durchaus sensibel für die Gefahren äußerer Oktrois. Heute werden diese stark mit „Brüssel“ identifiziert. Jedenfalls blieb Ethnizität ein zentraler Anknüpfungspunkt zur Bewahrung der eigenen Identität.
Besonders auch in Polen ließ sich der ethnische Faktor nicht von religiösen Hintergründen trennen. Widerstände gegen die kolonialisierende Dimension der liberalen Demokratie sind auch in der katholischkonservativen Publizistik dieses Landes immer wieder Thema. Einer ihrer führenden Vertreter, der Krakauer Philosoph Ryszard Legutko, einige Jahre Abgeordneter im EU-Parlament, konstatiert in seinem Buch „Der Dämon der Demokratie“ einen totalitären Grundzug im realen westlichen Liberalismus der unmittelbaren Gegenwart. 33 Legutko umschreibt die „erstickende Zudringlichkeit“ in diesem Modell folgendermaßen: Jede scheinbar siegreiche politische Formation, die sich am „Ende der Geschichte“ (Fukuyama) wähnt, neige zu Arroganz und Verabsolutierung. Legutko erwähnt den ersichtlichen Willen, Ehe, Familie, Gemeinschaftsleben, Sprache und Sexualität zu regulieren. Als Stichworte hierzu seien lediglich Gender-Mainstreaming und der Hang zur politischen Korrektheit angeführt. Auffallend sei der jakobinische Gleichheitsfuror, der alle Teile der Gesellschaft durchdringe. Weiter stellt Legutko völlig zu Recht fest, dass in etlichen EU-Staaten eine Inflation von Ansprüchen zu beobachten sei. Ihnen stünden jedoch keinerlei (oder kaum) Verpflichtungen gegenüber. Dieser Trend könne das Gemeinwesen nur schädigen.
Читать дальше