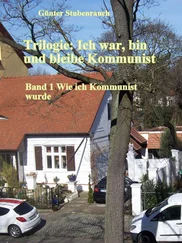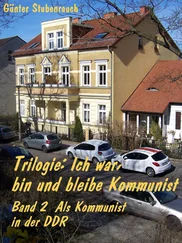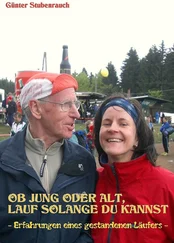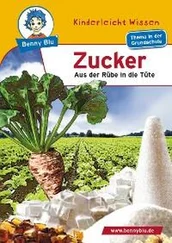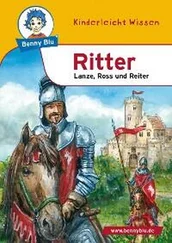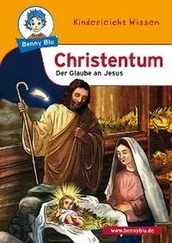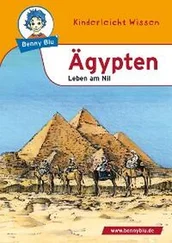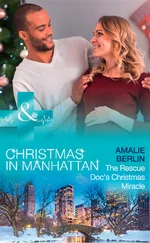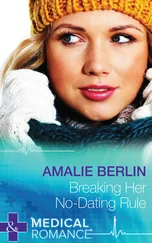In der Folge scheinen mehrere, nicht erhaltene Briefe zwischen Stuttgart und München expediet worden zu sein, da der Hoftheaterintendant von Lehr am 8. Juli bereits auf einen Brief vom 1. Juli antwortete, aus »welchem ich mit rechtem Vergnügen die Nachricht von der bereits getroffenen Einleitung zur Entlassung aus Ihrem bisherigen Verband und von der Hoffnung solche zu erhalten, entnommen habe.« Damit schien der Bühnen-Wechsel konkrete Formen anzunehmen. Nur die Frage nach dem Benefiz war noch ausstehend, doch von Lehr fürchtete, dass der König, der gerade auf zwei Monate abwesend war, einen diesbezüglichen Nachtrag nicht gewähren würde, »als Sr. König. Majestät Ihren Gehalt von 2500 fl. Ihnen nicht ohne Schwierigkeit bewilligt haben«, da er über der sonst üblichen Gage lag. Wie sehr man in Stuttgart darauf bedacht war, Amalie zu engagieren, beweist jedoch der weitere Inhalt des Briefs:
»Da indessen aus Ihrem letzten Schreiben vom 1. d. M. erhellt, daß Sie auf ein Benefice mit Sicherheit gerechnet haben […], so will ich die Sache auf mich nehmen und bewillige Ihnen daher das verlangte jährliche Benefice.« 128
Nun musste auch die Hoftheaterintendanz in München aktiv werden und »das Gesuch der Hofschauspielerin Amalie Stubenrauch um Urlaubs-Bewilligung auf ein Jahr zur ferneren praktischen Ausbildung« an den König weiterleiten, der sich ja allgemein die Gewährung von Urlaub ausbedungen hatte. Intendant von Poißl befürwortete das Urlaubsgesuch auf ein Jahr. König Ludwig I. hatte nichts dagegen und schrieb am 26. Juli höchst eigenhändig auf den Rand des Gesuches:
»Diesen Antrag insoweit derselbe die Schauspielerin Stubenrauch betrifft, genehmigt, der ich für’s zweckmäßigste halte, während ihrem Urlaub einen Theil ihres Gehaltes auf Zahlung fremder ausgezeichneter Schauspielerinnen zu verwenden.« 129
Nun erfuhr auch das Münchner Publikum von der bevorstehenden Veränderung aus der Zeitung, wenn sich das Gerücht nicht schon vorher hinter vorgehaltener Hand verbreitet hatte. Allerdings war man nicht ganz überzeugt, ob ihre Entscheidung die richtige sei. 130 Amalie erhielt zunächst, laut ihrem Schreiben vom 24. August, von König Ludwig I. Urlaub auf ein Jahr, doch:
»Die hiesige Hoftheaterintendanz ist vollkommen davon unterrichtet, daß mir Eurer Hochwohlgeboren ein Engagement für 3 Jahre angeboten hat, und ich darf daher hoffen, meinen Urlaub verlängert zu sehen, wenn ich in meinen Kunstleistungen den kgl. Hofe und dem Publikum in Stuttgart zusagend, darum einkommen sollte. Ja, auch unverzüglicher Entlassung würde nichts im Wege stehen, sollte mir nach dem Verlauf dieser 3 Jahre oder schon früher von Ihrer Seite der Wunsch ausgedrückt werden, Ihrer Anstalt für immer anzugehören.« 131
Die Antwort erfolgte postwendend am 29. August 1828. Demnach habe König Wilhelm I. die Anstellung der Demoiselle Amalie Stubenrauch aus München als Hofschauspielerin am Stuttgarter Theater gnädigst zu genehmigen geruht. Als Dauer des vorläufigen Engagements wurde der Zeitraum vom 1. Oktober 1828 bis 30. September 1829 angegeben. Dafür erhielt sie 2 500 Gulden sowie eine »jedoch nicht kostenfreie Benefiz-Vorstellung«. Allerdings haben die Schwaben andere Kosten auf sie abgewälzt. Daher erlaubte sie sich »dagegen eine Vorstellung zu machen, nehmlich die mir gemachte Forderung, für die Moderne Garderobe und Chaussure selbst Sorge zu tragen« sowie die Bitte zu äußern, als erste Rollen Donna Diana und Olga spielen zu dürfen. Amalie schloss ihr Schreiben mit dem Hinweis auf ihre unaussprechliche Freude, den Augenblick immer näher rücken zu sehen, »der mich meiner neuen Bestimmung entgegenführt.« Die Freude dürfte höchstens dadurch etwas getrübt worden sein, dass die Intendanz auf dem Punkt der »französischen Kleider-Beschaffung« bestand, da er angeblich allgemein bei allen Schauspielern in Stuttgart Teil der Vereinbarungen war, die über 1 500 Gulden verdienten. Die Kosten für die Garderobe wollte Amalie aber nicht übernehmen und hakte nochmals nach. Ob mit Erfolg oder nicht, verschweigen die Akten. Auch der Urlaub auf ein Jahr war bewilligt, einem Neuanfang in Stuttgart stand nichts mehr im Weg. 132
König Ludwig I. von Bayern und das Porträt Stielers
Auch wenn einige von Amalies Widersachern spekulierten, sie hätte in München ein Verhältnis mit König Ludwig I. angefangen, gar ihn für ihren Karriereeinstieg benutzt – diese Jahre später in die Welt gesetzten Gerüchte erweisen sich bei genauer Betrachtung als haltlos. Es findet sich kein stichhaltiger Beleg, dass Ludwig mehr als ein applaudierender Zuschauer war, wenngleich er sich dem weiblichen Geschlecht gegenüber stets aufgeschlossen zeigte. »Lieben muß ich, immer lieben«, hat er einst gedichtet und »unverliebt kann ich nicht sein«. 133 Zusammen mit den zahlreichen Anekdoten, der berühmten Schönheitsgalerie, die noch heute in Schloss Nymphenburg alljährlich Tausende von Besucher anlockt, und der immer wieder gerne kolportierten, schicksalhaften Affäre mit Lola Montez verfestigte sich das Bild eines Lüstlings auf dem Königsthron – zu Unrecht. Gerade das kunstgeschichtlich einmalige Phänomen der Schönheitsgalerie lässt Ludwigs Verständnis von Frauenschönheit begreiflich werden, das weniger auf Beziehungen zur Damenwelt zurückging, als vielmehr mit seiner Verehrung für das ›Schöne‹ an sich zu tun hatte.
Die Idee zu dieser Galerie war bereits in seiner Kronprinzenzeit gereift. Kaum auf dem Thron begann er die Idee durch den Maler Joseph Stieler in die Tat umzusetzen. 1829 konnten die ersten zehn Bildnisse der Allgemeinheit in einer Kunstausstellung vorgestellt werden. Im Laufe von gut 20 Jahren kamen insgesamt 38 Porträts zusammen. 134 Von Anfang an war die Galerie für die Öffentlichkeit gedacht, nicht zum königlichen Privatgenuss – anders als etwa die Galerie des württembergischen Königs Wilhelm I. Unter den ersten zehn Bildnissen, die 1829 in München ausgestellt wurden, befand sich auch das Porträt der Amalie von Stubenrauch. Während im »Kunstblatt« nur allgemein über die Porträts, die »in hohem Maße die Schaulust der Neugierigen« reizte, berichtet wurde, führt der Bericht im »Münchner Conversations-Blatt« die einzelnen Dargestellten namentlich auf.
Unter der Überschrift »Die abentheuerliche Nacht« beschrieb der äußerst beliebte Schriftsteller Friedrich Wilhelm Bruckbräu die Bilder, die er um eine fiktive Tafel vereint zu Leben erweckte. Goethe auf dem berühmten und nachweislich ausgestellten Porträt hatte den Vorsitz. »Zu beiden Seiten von ihm saßen Demoiselle Stubenrauch, k. würtembergische Hofschauspielerin, auf einem eleganten Teller vor ihr lag eine Rose, ein Vergißmeinnicht, und ein Je länger je lieber, für eine Dame drei sinnvolle Blumen; dann Demoiselle Hagn als Thekla, in einem mit Pelz verbrämten Kleide von weißem Atlas, mit Perlen geschmückt, behaglich in einem Armstuhl ruhend«, dazu acht weitere Schönheiten.
»Was halten Sie von meinem Portraite?« fragte Amalie von Stubenrauch demnach den Schriftsteller. Man kannte sich: Bruckbräu arbeitete auch als Theaterautor; Amalie war etwa im Fasching 1827 als Amalie Gräfin von Rosenberg in einem Lustspiel von Bruckbräu aufgetreten. Doch das Stielersche Porträt gefiel ihm nur bedingt: »Es fehlt ihm alle Wahrheit, aller Charakter«, erwiderte Bruckbräu, »so ähnlich es auch ist. Aus dem Gesichte leuchtet die Champagnerglut einer Lady Milford, aber nicht jenes schelmische Verhehlen der innern Gesinnung, was Sie im wirklichen Leben so interessant macht.« Und ergänzte:
»Ich spreche übrigens dieses Urteil nicht aus einem vielleicht gerechten Grolle aus, weil Sie durch Ihren Abgang unsere Bühne einer theuren Zierde beraubt haben, indem ich wohl weiß, daß nur eine h ö h e r e Liebe Sie an Stuttgart fesseln kann, nämlich die Liebe zur Kunst, welcher Sie sich dort als tragische Prima-Donna ungetheilt weihen können.« 135
Читать дальше
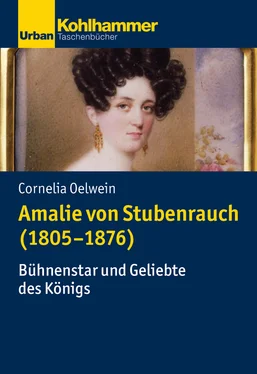
![Amalie Brook - Пыльными дорогами. Путница [СИ]](/books/412274/amalie-brook-pylnymi-dorogami-putnica-si-thumb.webp)