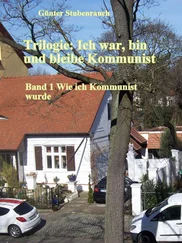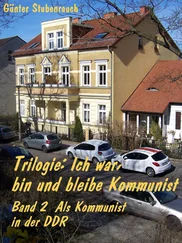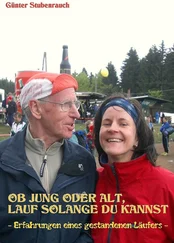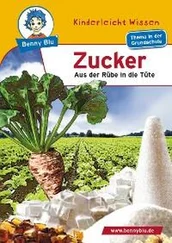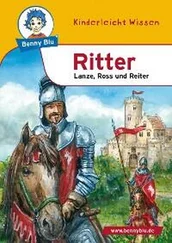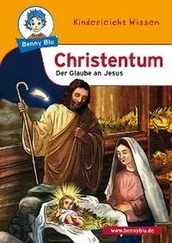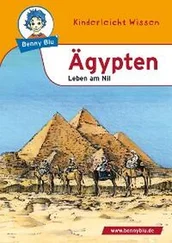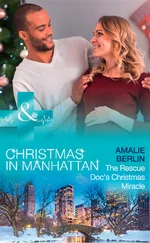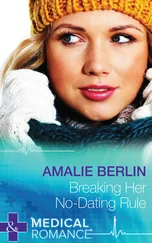Am 27. September fuhren König Wilhelm und seine Frau Pauline zurück nach Stuttgart, während Amalie als Preciosa und als Victor von Luceval in »Die Waise und der Mörder« auf der Bühne des Münchner Hoftheaters glänzte sowie als Bertha in der »Ahnfrau« und nicht zuletzt als Elsbeth in »Die drei Wahrzeichen oder das Turnier von Kronstein«, wo »ihr schönes Spiel« wiederum »die ihr zu Theil gewordene Anerkennung« verdiente. Am 24. November 1827 sah man sie dann in Schillers »Wilhelm Tell« – einer Aufführung zu Gunsten des in Stuttgart geplanten Monuments für den Dichter. Möglicherweise weckte diese Aufführung erneut Amalies Fernweh. Jedenfalls verfasste sie am nächsten Morgen einen Brief an den Münchner Hoftheaterintendanten von Poißl.
Frankfurt, Darmstadt und unerfreuliche Begegnungen
In dem Schreiben vom 25. November 1827 bat sie den Intendanten des Münchner Hoftheaters um einen Urlaub zu Ausbildungszwecken. Sie wolle als Gast in anderen Städten Erfahrungen sammeln, obwohl ihr bewusst sei, dass der Zeitpunkt nicht gerade günstig wäre. Sie wollte in Frankfurt am Main sechs ihr angebotene Gastrollen wahrnehmen. Die »Agnes Bernauer« im gleichnamigen Vaterländischen Trauerspiel von Josef August Graf von Törring, das in einer Neueinstudierung am 16. Dezember auf dem Programm stand, wollte sie noch spielen. Danach könnten alle sie während ihrer Abwesenheit treffenden Partien leicht von Charlotte von Hagn oder Fanny Fleckenstein übernommen werden. 92
Die Hoftheaterintendanz lehnte ihr Gesuch postwendend ab. Begründung: Ihre Anwesenheit gerade im Dezember wäre äußerst wichtig, da in diesem Monat und bis zum Beginn des Karnevals das Theater die beste Zerstreuung des Publikums biete. Im Sommer Urlaub zu erhalten war entschieden einfacher als im Winter. Der Hof, der Adel und zum Teil auch das Bürgertum befanden sich in einem der Kurorte, in den Landhäusern sowie in der Sommerfrische, oder man verlustierte sich bei Wanderungen und nicht zuletzt im Biergarten. Die Theater waren folglich nicht gerade überfüllt, wenn denn überhaupt gespielt wurde. Doch in der Wintersaison bedurfte man der guten Kräfte. Die Intendanz ließ sich daher lediglich dazu durchringen, die Genehmigung zu einer Gastspielreise während der Karnevalstage in Aussicht zu stellen. Allerdings scheint sich Amalie letztlich aber doch durchgesetzt zu haben. Denn am 19. Dezember 1827 konnte man dem »Tags-Blatt für München« entnehmen: »Dlle [Demoiselle] Stubenrauch ist nach Frankfurt abgereist, um dort zu gastiren.« 93 Laut Theaterzettel hätte sie noch am 24. Dezember die Donna Fenisa in »Donna Diana« spielen sollen, doch dazu war es nicht mehr gekommen. Sie stand bereits am 23. Dezember als Irene in »Belisar« auf der Frankfurter Bühne. Die Rolle war jedoch nicht glücklich gewählt, da Demoiselle Lindner, der Star des dortigen Theaters, bisher das Frankfurter Publikum verzaubert hatte. Und so schieden sich die Geister in der Berichterstattung.
Während das sonst eher zurückhaltende »Tags-Blatt für München« 94 von Begeisterung sprach, soll Amalie nach anderen Quellen beim dortigen Publikum nicht den erhofften Beifall gefunden haben, da sie den Vergleich mit der Frankfurter ersten Liebhaberin nicht gewinnen konnte. Und so war in einer Frankfurter Zeitung zu lesen: »Wie diese Rolle gespielt werden müsse, zeigte uns Dlle. Lindner. Nicht so Dlle. Stubenrauch.« Auch ihre Darstellung der »Preciosa« konnte die Frankfurter nicht vollends überzeugen. In diesem Fall waren es nicht ihre Deklamations- sondern ihre Reitkünste, die missfielen. In der Mainmetropole musste die Zigeunerin nämlich hoch zu Ross auf die Bühne reiten. Und das in München erscheinende Unterhaltungs-Blatt »Flora« kommentierte die Frankfurter Kritiken spöttisch mit den Worten: »Überdieß klagen die Liebhaber der edlen Reitkunst, sie habe schlecht zu Pferde gesessen, die Freunde des Gesanges ärgerten sich, weil sie nicht gesungen, und die Anhänger Terpsichorens, weil sie nicht getanzt habe.« 95
In den Münchner Blättern wurde Amalie größtenteils ausführlich verteidigt, der »Eos« holte sogar zu einem »Rundumschlag« gegen das Frankfurter Theater-Publikum und die Zeitungskonkurrenz aus:
»Das Frankfurter Theater ist, namentlich in Bezug auf das Schauspiel, gegenwärtig nicht mehr was es war. Statt gebildeter Zuschauer sieht man am meisten nur Ladendiener, junge Hebräer und gemeine Leute aus den Vorstädten im Theater, die hochgestellt in ihrer paradiesischen Sphäre über Logen und Parterre, ihre Kennerschaft am liebsten bei ernsthaften Vorstellungen geltend machen, um es an Spaß für sich und andere nicht fehlen zu lassen. Wer zu den Sitzen hinaufblickt, von wo dieser olympische Plebs als richtende Macht seine Blitze versendet, sieht recht wohl mehr Dunst als Sinn für die Kunst und daß auch zu solcher Höhe sich die Intrigue versteigt, um die imponirende Derbheit und den göttlichen Unverstand, welche dort thronen, dieses zu läugnen.« 96
Es folgen noch mehrere negative Kommentare, bevor der Kritiker auf Amalie von Stubenrauch zu sprechen kommt:
»Unter solchen Verhältnissen blieb natürlich die Schöne und das Schöne ohne Wirkung, und kaum war das Gericht vollzogen und die Künstlerin geopfert, der anderwärts so gern sich andere opfern, da machte schnell Merkur sich auf den Weg, um einer Blumengöttin, die zu München weilt [i. e. die Zeitung »Flora«], und der er sinnverwandt sich fühlt, ihr Loos mit seinem Schlangenstab in ihre Blätter einzuzeichnen.« 97
Ihre weiteren Gastrollen waren Bertha in der »Ahnfrau«, Olga in »Isidor und Olga« und Amalie in Schillers »Räuber«. Letzteres Stück wurde zu ihrem Vorteil aufgeführt. Und nun hatte Amalie von Stubenrauch endlich den gewünschten Erfolg: »Der Künstlerin, die es früher dem Olymp nicht recht machen konnte, gelang es nun […] der kleinen Zahl der Kenner zu behagen, die nach der Kunst allein Verlangen tragen.« 98
Auch der Frankfurter Korrespondent des »Bayerischen Volksfreunds« bestätigte nicht nur den schlechten Zustand der dortigen Bühne, bei der »mit Ausnahme der Oper Hopfen und Malz verloren« wären, sondern auch, dass falsche Behauptungen und Übertreibungen über die Auftritte von Amalie in Umlauf gesetzt worden seien. 99
Es dauerte nicht lange, und die ›Revanche‹ folgte. Im Frühjahr 1828 gastierte Demoiselle Lindner aus Frankfurt in München. Sie spielte die Chatinka in »Das Mädchen von Marienburg« und konnte ihrerseits nicht überzeugen. »Höchst spärlich, ja beinahe gar keine Zeichen von Beifall wurden dem Gast gegeben«, es wurde gar gezischt und nur die anderen Schauspieler gerufen, sogar die »auf der untersten Bühnenstufe stehenden«, beklagte sich der Referent des »Eos«, der dies nicht verstehen konnte und ihr natürliches Spiel wortreich hervorhob. Dass diese Ablehnung lediglich eine Retourkutsche von Stubenrauch-Anhängern war, ist nicht anzunehmen. Vielmehr wird es sich um die unterschiedliche Art der Darstellung gehandelt haben, denn gerade das Pathetische der Stubenrauch war ja vor allem in Frankfurt kritisiert worden. Die Geschmäcker sind verschieden, auch die Auffassung, wie ein Stück gegeben werden sollte. Allerdings fürchtete der Schreiber im »Eos« nun wiederum die Reaktion in den Frankfurter Blättern, da man »bei dem bekannten Blätterkampfe über die Gastdarstellungen der Demoiselle Stubenrauch in Frankfurt, zum Lobe der Letzteren nicht Worte genug gefunden, um das Frankfurter Publikum zu einem Janhagel und ästhestischen Plebs herabzuwürdigen, um das Mißfallen jener Schauspielerin auf der Frankfurter Bühne zu entschuldigen, und in das beliebte vortheilhafte Licht zu setzen. Zu erwarten stund, daß, was dort unsere Landsmännin in tiefen Schatten stellte, hier von einer Parthei gleichfalls würde in Schatten gestellt werden.« 100
Kurzum: Die Gastspielreise nach Frankfurt konnte von Amalie nicht als Erfolg gesehen werden. Auch ihre Münchner Konkurrentin Charlotte von Hagn hat dies mit einiger Genugtuung wahrgenommen. 101 Zu allem Überfluss wurde Amalie auf der Reise an den Main ein Koffer gestohlen, in dem sich ihre schönsten Kostüme befanden. Diese galten als »wesentliches Wirkungsmittel der dramatischen Kunst einer jungen Schauspielerin« und stellten zudem einen großen finanziellen Verlust dar. Es war nämlich üblich, für die Garderobe selbst aufzukommen. Deshalb ging in München sogar das Gerücht um, dass ihre Freundin Elise Seebach eine Kollekte zur Minderung des Schadens veranstaltet habe, was diese jedoch umgehend dementierte. Ja sie nannte denjenigen, der das Gerücht gestreut hatte, angeblich öffentlich einen »schadenfrohen-offensiven Lügner«. 102 Dem wurde freilich wiederum von Amalies Vater mit scharfen Worten widersprochen und so blieb das Thema noch länger in den Medien präsent. 103 Es ist erstaunlich, welches Medieninteresse der verlorene Koffer und vor allem die Nachgeschichte hervorriefen.
Читать дальше
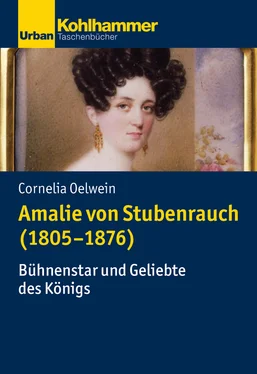
![Amalie Brook - Пыльными дорогами. Путница [СИ]](/books/412274/amalie-brook-pylnymi-dorogami-putnica-si-thumb.webp)