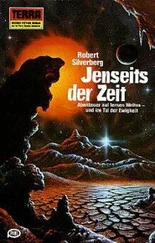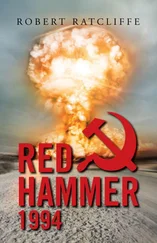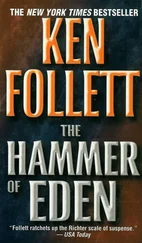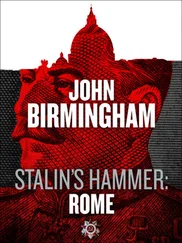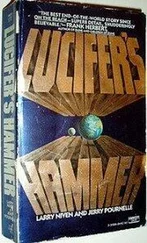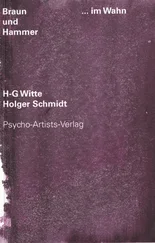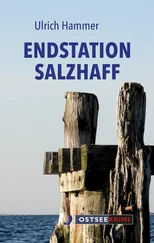»Ja … nee, das war nur so ein Gedanke vom Notarzt.«
»Der hat ihn sich doch gar nicht gründlich angesehen«, entgegnete einer der Männer.
»Der muss die Befunde am Hals gesehen haben«, sagte Brandenburg. »Wie käme er sonst auf einen gewaltsamen Tod. Dazu muss er schon dicht herangegangen sein, sonst wäre ihm das nicht aufgefallen. Also ganz so schlecht war der nicht! Habt ihr sonst noch was gefunden?«
»Nein, noch nicht, wir haben aber auch bei der Dunkelheit noch nicht alles gründlich absuchen können. Machen wir morgen. Die Zuwege werden bis dahin gesperrt. Außerdem sollen die Hunde ran. Wir haben keine Zeugen.«
»Habt ihr den Bestatter informiert?«
»Der ist unterwegs.«
»Den Totenschein schreibe ich morgen im Saal«, rief Brandenburg. »Die Todeszeitschätzung auch morgen, wenn ich ihn gewogen habe. Das wird wohl so der frühe Nachmittag gewesen sein. Lasst uns aber jetzt und nicht erst morgen Abriebe von der Halshaut für molekulargenetische Untersuchungen anfertigen und die Fingernagelkanten nicht vergessen. Das muss jetzt. Und noch eins«, rief er dem Kriminaltechniker zu, »wenn ihr die Hände eintütet, bitte keine Plastiktüten, sondern Papier, damit die nicht schwitzen!«
»Alles klar, Doc.« Sie würden die Hände ohnehin gleich hier abkleben, damit auf dem Transport keine Spuren verloren gingen.
Brandenburg legte den Verstorbenen vorsichtig in seine ursprüngliche Lage zurück, als neben der rechten Hand ein flacher Gegenstand das Lampenlicht reflektierte. »Stopp mal, ich hab hier noch etwas! Bitte ein Foto. Er wies auf eine silbrig glänzende, kantige Kontur. Der Kriminaltechniker stellte eine Nummer daneben, fotografierte und Brandenburg strich das Laub vorsichtig zur Seite. »Ein Smartphone, scheinbar nicht beschädigt. Hätten wir fast nicht gesehen. Habt ihr eine Tüte? Dann her damit und rein damit!«
Brandenburg erhob sich, klappte seinen Dienstkoffer zu und stelzte vorsichtig aus dem sensiblen, inneren Bereich des Tatortes. Dann drehte er sich um: »Ach, noch etwas, meine Herren« und erinnerte an Columbo, dem auch immer noch eine letzte Frage einfiel. »Wie bezeichnet ihr den Auffindungsort? Ich brauche für die Todesbescheinigung eine genaue Ortsangabe. Einfach nur ›Grundloses Moor‹ reicht nicht.« Da fiel ihm ein, das er sich selbst helfen konnte. Er zückte sein Smartphone, ging zum Leichnam zurück und ließ sich die Geokoordinaten des Auffindungsortes anzeigen. »Danke, hat sich erledigt.«
Die Kriminaltechniker verabredeten dann das Prozedere für den kommenden Vormittag. Man würde sich aufteilen müssen. Zwei Leute in den Saal, der Rest in den Wald.
Brandenburg verabschiedete sich, bekam einen freundlichen Wink und dann ging er vorsichtig zurück zu seinem Auto. Der schwarze Wagen hob sich kaum vom Dunkel des Waldes ab, sodass er Mühe hatte, ihn zu sichten. Dort angekommen wurde er schon wieder von der eigenen und scheinbar unbeirrbaren Atmosphäre des Waldes eingefangen. Er stieg schnell ein und mit dem Zuklappen der Tür und dem Einschalten des Radios war diese Stimmung abgeschnitten.
Von der Straße näherten sich Scheinwerfer in unruhigen Bewegungen. Die Bestattungsfirma navigierte sich den Waldweg entlang. Er würde ihnen noch kurz Bescheid geben, dass der Verstorbene am nächsten Vormittag gegen neun Uhr im Institut sein sollte.
Brandenburg steuerte in Gedanken versunken seinen Wagen nach Hause. Wenig später empfing ihn die wohlige Wärme seines Hauses. Seine Ehefrau Anna war zu einer Freundin gefahren, die Kinder längst aus dem Haus, sodass er mit den Eindrücken vom Tatort allein war und in Ruhe alle Informationen Revue passieren lassen konnte.
Am nächsten Morgen brauchte er keine Anlaufzeit. Zum Frühstück kurz was abgebissen und ab zum Institut. Dort begann einer der zahllosen Morgen, die er in seiner langen Dienstzeit durchlebt hatte. Ganz gleich wie die Auftragslage war. Man wurde immer von diesem düsteren Gemäuer empfangen, von dieser alten Villa, die durch viele Umbauten zu einer »Struktureinheit« geworden war, wie es früher im Verwaltungsjargon hieß.
Auf dem Flur vermengt sich der Duft
von Dachstuhl und modriger Kellergruft ,
hatte er mal gereimt. Die nie aus den Wänden heraussanierte Feuchtigkeit wurde mit jedem Atemzug eingesogen.
Vor uns sind zertretene Stufen ,
die uns in die Tiefe rufen ,
schrieb er damals weiter .
Selbst da ,
wo einst der Holzwurm war, bleibt nur noch modrig seine Höhle.
Vom Wurm fehlt längstens Leib und Seele.
Es war sehr speziell und irgendwie ein Wunder, dass er es dort schon so viele Jahre aushielt. Die letzten Jahre hatten eine für ihn überraschende Entwicklung gebracht. Das enge, unerbittlich Geradlinige und damit oft blockierende frühere Regime des Hauses war einer Experimentierfreude und einem offensiven Arbeitsstil gewichen, natürlich verbunden mit der Forderung nach Übersicht, um die streng gebliebenen Basics immer wiederzufinden. Jeder neue Fall geriet in eine produktive Workshop-Atmosphäre und wurde in alle Wissenschaftsbereiche des Hauses getragen. Nach dem Prinzip »Universität«.
Die morgendliche Dienstberatung bekam die Geschehnisse der letzten Nacht auf den Tisch. Der Termin zur Obduktion wurde vom Chef bestätigt, das Team zusammengestellt. Schnell noch einen Kaffee und ab in den Saal. Dazu war eine Fahrt durch die Stadt notwendig. Seziert wurde im Gebäude der Pathologie. Der Sektionstechniker war schon seit ein oder zwei Stunden im Dienst und gerade dabei, den Verstorbenen vom Bestattungsunternehmer entgegenzunehmen. Übergabe der Papiere, Unterschriften, Terminabsprachen, ein Wink, ein Gruß. Das ging alles sehr schnell als Teil einer jahrelang gut funktionierenden Routine.
Im Saal versammelten sich die beiden Obduzenten, der Sektionstechniker, die Staatsanwältin und ein Kriminaltechniker, den die Kollegen nur »KT-Mann« nannten und der für seine Fototechnik einen kleinen Rollwagen benutzen konnte, der grün abgedeckt wurde.
»Frau Staatsanwältin, wir kennen uns ja noch gar nicht«, mit diesen Worten ging Doktor Brandenburg auf eine hoch gewachsene, junge Dame zu, die in grünem Kittel den Saal betreten hatte. Hochhackige Schuhe in schlappenden Gummigaloschen. Die Nasenöffnungen mit parfümiertem, klein gerissenem Papier zugestöpselt.
»Tut mir leid«, näselte sie, »aber ich bin nicht die Staatsanwältin, sondern die neue PJlerin.« Seit einigen Jahren durften Studierende einen Teil des Praktischen Jahres auch in Instituten für Pathologie und Rechtsmedizin ableisten, das sogenannte Wahltertial.
»Ah, dann habe ich gleich einen kleinen Maßnahmenkatalog aufzusagen. Erstens Stöpsel aus der Nase, zweitens vernünftiges Schuhwerk und drittens nach Erledigung wiederkommen!« – »Das geht ja wohl überhaupt nicht«, sinnierte er vor sich hin. ›Nasenstöpsel und dann diese Stelzen! Der werd ich Luft machen. Gutes Stichwort!‹ – »Bitte die Fenster zu, ich will nicht immer wieder erinnert werden, dass es draußen schöner ist als hier.«
Der neue Tag hatte mit wolkenlosem Himmel begonnen und verteilte eine spätherbstliche Frische in die Straßen der Stadt, die aber leider draußen bleiben musste. Die Studentin erschien wieder, etwas verwandelt und scheu, aber Brandenburg hieß sie nun herzlich willkommen und wünschte ihr interessante vier Monate. Er zeigte ihr, wo die Handschuhe lagen, sie möge sich ein Paar überziehen und sich bereithalten … jedenfalls dicht am Tisch bleiben. »Zuwendung ist die halbe Miete!«
Endlich kam auch die richtige Staatsanwältin. Frisch im Amt, Franziska Kernbach. Jung, dynamisch, erfolgsgewohnt, straffer, federnder Schritt, knapper Gruß, fordernder Rundumblick. Es konnte losgehen.
Читать дальше