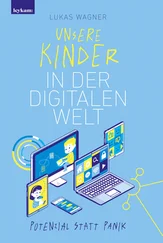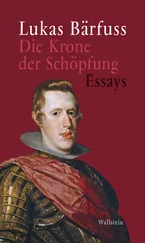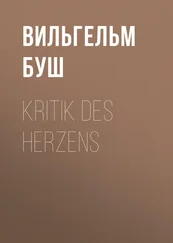Lukas Bärfuss’ Bildungshunger erwachte, systematisch arbeitete er dieses Lexikon durch, von A bis Z, fand zu den Büchern, fand zur Literatur als Gegenort, als Ort des Möglichen, des Nicht-Tatsächlichen, von dem aus das Tatsächliche in den Blick genommen werden kann, als »Rastplatz der Reflexion«, wie einmal der Sozialphilosoph Oskar Negt den gesellschaftlichen Wert der Literatur, des Theaters, der Kunst überhaupt beschrieb. Bärfuss las und las, suchte die klassischen Grundtexte unserer Zivilisation auf und entwickelte das untrügliche Gefühl, dass diese Lektüren mit seinem eigenen Leben zu tun haben. Er begann die Zeit zu vermessen zwischen dem Damals und Heute und untersuchte, was geblieben ist und was sich verändert hat. Er absolvierte eine Buchhändlerlehre und beschloss Schriftsteller zu werden, und er ist, wenn man ihm glauben darf, noch heute überrascht, dass diese kühne Behauptung gesellschaftliche Akzeptanz erfahren hat.
Und genau darum geht es Lukas Bärfuss fortan auch in seinem Schreiben: um gesellschaftliche Zuschreibungen, Verabredungen, Akzeptanz und natürlich – die versteckte Gewalt, die davon ausgeht und Fluchtversuche provoziert, die besonders in Bärfuss’ Prosa Thema sind. Seine drei Romane sind so stark, so konzentriert, so intelligent entwickelt, dass ich an dieser Stelle darauf verzichten muss, sie in der Kürze der mir gegebenen Redezeit anzureißen. Ich kann sie nur jedem anempfehlen und ich hoffe, in dieser Laudatio eine Spur für ihre Lektüre zu legen, denn auch sie handeln von jenen Verhaltensparadoxien.
Vielleicht verdankt sich die geschärfte Beobachtungsgabe für die blinden Flecken in unserem Selbstverständnis dem Parzival’schen Blick – eines, der verspätet in die Gesellschaft integriert wird, der die Sozialisation erst im jungen Erwachsenenalter nachholt und daher diesem Gemeinwesen gegenüber, bei dem er um Aufnahme ersuchte, die Distanz behält. In »Parzival«, einem dieser Grundtexte, sieht Bärfuss den Urkonflikt des Schriftstellers verhandelt, der sich einerseits danach sehnt, Teil jener Gesellschaft zu sein, die er beschreiben möchte, der sich wünscht, mitten in ihr zu stehen, von allem berührt zu werden, die größtmögliche Zeitgenossenschaft und Durchlässigkeit zu haben – der aber andererseits für und durch seine Arbeit als Dichter eine Distanz aufbaut. Dichtung, so Bärfuss, sei nur möglich in diesem Widerspruch.
Vielleicht ist es diesem verspäteten Einstieg in die Bildung auch zu verdanken, dass wir es bei diesem Autor mit einem so eigenständigen, unkorrumpierbaren Denker zu tun haben, der sich die Zeit nimmt, die es braucht, alles selber zu durchschreiten, sich selber zu erarbeiten, schreibend. »Was die Welt sagt und was in den Büchern steht, das kann nicht maßgebend für mich sein. Ich muss selber nachdenken, um in den Dingen Klarheit zu erlangen.« Diese letzte Replik aus Ibsens »Nora« zitiert Bärfuss oft und meint sich selbst. Er riskiert Umwege, viele, aber keine Abkürzung.
Die Gesellschaft, die Öffentlichkeit – Sie merken: ich reite ein wenig darauf herum – ist sein Thema. Und: Er meidet sie nicht. Im Gegenteil. Tatsächlich ist er ein brillanter »Öffentlichkeits-Arbeiter«: in seinen Reden, Vorlesungen, seinen hellsichtigen Essays lässt er uns explizit teilhaben an seinen Bildungsprozessen, den Entwicklungen seiner Fragestellungen.
Jeder Auftritt, jedes Buch, jede seiner Veröffentlichungen liest sich als die Fortsetzung eines Gesprächs, für das er mich, den Leser, Hörer, Zuschauer als Gegenüber sucht und – deswegen fühlt man sich wohl in seiner Nähe – in all seinen Irrtümern ernst nimmt. Bärfuss’ Texte sind adressiert, da spricht jemand, der Austausch sucht. Auch deshalb kann man sich ihnen nicht entziehen. Sein unumstößliches Vertrauen in das Gelingen einer Gedankenarbeit, die ihre Kraft aus sokratischer Selbstbefragung bezieht, ist sehr tröstlich und emanzipiert sein Gegenüber, das er darin einbezieht. In diesem Sinne ist Bärfuss ein Aufklärer, denn Aufklärung ist ein Modus des Denkens und, wie wir wissen, etwas Unabschließbares. Er hört nicht auf zu fragen: Was bedeutet das? Wer hat die Deutungshoheit – über die Gesellschaft, über sich selbst, sein Leben, seine Rolle?
Es geht ihm aber auch um die Möglichkeiten der Veränderung, eben jene Verwandlung, für die Bärfuss das Theater so liebt, das Verwandlung zeigt und Verwandlung ermöglicht. Es geht ihm um die Möglichkeiten der Veränderung auch außerhalb des Theaters. Er ist wahrhaft ein zoon politicon, ein politischer Mensch, der das Gemeinwesen zum Hauptgegenstand seiner Untersuchungen und – das ist herauszuheben – seines Handelns macht: Als Vater seiner Kinder und als Bürger eines Staates.
Daher scheut er auch nicht die Einmischung: 2015 zum Beispiel, vor den Schweizer Parlamentswahlen, veröffentlichte er in der »FAZ« einen eindringlichen Warnruf, der auf den Rechtsruck der Medien seines Landes aufmerksam machte, auf die Auswechslung von unliebsamen Journalisten in den Redaktionen, die bis dahin weitgehend unkommentiert geblieben war. Was darauf folgte war ein Sturm der Entrüstung. Man warf ihm Paranoia vor. Sein Schriftstellerfreund Pedro Lenz hatte ihm noch zugerufen: »Ich warne Dich vor der Rache derer, die Du herausforderst. Sie werden Dich plagen und anonyme Hassmails schicken. Auf Dich als Person werden sie zielen, so wie es die Intellektuellen-Jäger der ›Weltwoche‹ schon vorgemacht haben.« In den zahllosen sich anschließenden Interviews sah man Lukas Bärfuss denn auch seine Sehnsucht an, an den Schreibtisch zurückkehren zu dürfen, doch betrachtet er den unbotmäßigen Eingriff in die Macht- und Herrschaftsverhältnisse als selbstverständliche Verpflichtung des politischen Intellektuellen.
Übrigens: Das einzige Wort, das Lukas Bärfuss für seine Poetik gelten lassen möchte, lautet: Trotzdem.
1Gehalten am 2. November 2019 in Darmstadt.
Gregor Dotzauer
Aufatmen im Gegenwind Das Phänomen Lukas Bärfuss
Habituelle Provokateure sind eine Plage für jede Medienrepublik. Unter dem Vorwand, unliebsamen Wahrheiten Gehör zu verschaffen, bewerben sie oft nichts anderes als die eigene Marke, und je mehr sie dabei angeblich minoritäre Meinungen kundtun, desto stärker setzen sie insgeheim auf das Einverständnis der schweigenden Mehrheit. Auch Lukas Bärfuss muss sich diesen Vorwurf gefallen lassen: Als ausgewiesener Linker bedient er, von Rechtskonservativen regelmäßig angefeindet, zumindest die Bedürfnisse eines liberalen Kulturpublikums. Wer sich der radikalen Ernsthaftigkeit seiner Bücher und Theaterstücke aussetzt, stößt allerdings nirgends auf einen narzisstischen Spieler.
Bärfuss braucht den Gegenwind zum Atmen, und er macht seinem fortgesetzten Ärger Luft, um nicht an den Schweizer Verhältnissen zu ersticken. Seine Wortmeldungen und Kolumnen sind Ausdruck eines psychohygienischen Grundbedürfnisses, der vor kaum einem Aspekt des öffentlichen Lebens haltmacht. So kontinuierlich wie unroutiniert tut er das Unvermeidliche im Aussichtslosen. Darin liegt, über alle Lagerpolaritäten hinaus, der Unterschied zu Antipoden wie dem notorischen Wider-den-Stachel-Löcker Roger Köppel, dem Verleger und Chefredakteur der »Weltwoche«, der seit 2015 für die nationalkonservative SVP im Nationalrat sitzt.
Unter dem Titel »Die Schweiz ist des Wahnsinns« veröffentlichte Bärfuss 2015 in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« einen »Warnruf« 1, mit dem er vor allem in seiner Heimat Empörung auslöste. Ausgehend von einer »Suissemania« genannten Sammelbildaktion der größten Einzelhandelskette Migros mit 50 nationalen Sehenswürdigkeiten, sah er sein vor den Parlamentswahlen stehendes Land auf einem rechten Irrweg. Bärfuss störte sich insbesondere an dem Wort Manie und diagnostizierte nach einem Blick in den Pschyrembel »eine psychotische Störung der Affektivität, häufig mit Wahnvorstellungen und Katatonie verbunden«. 2
Читать дальше