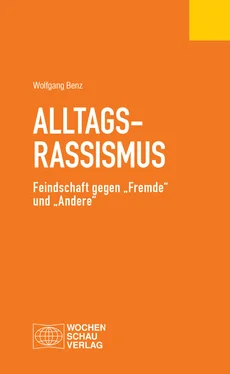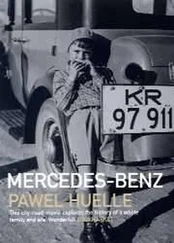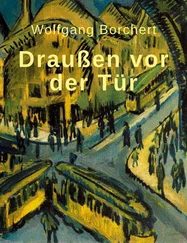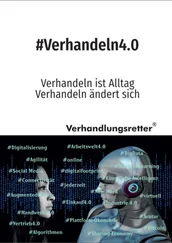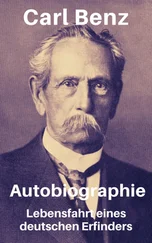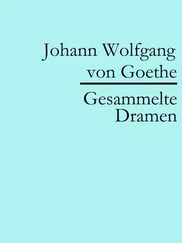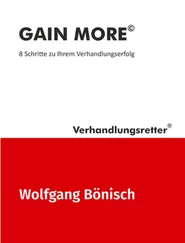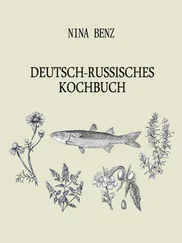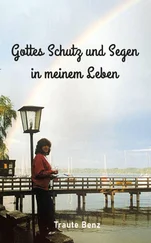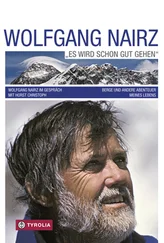Wolfgang Benz - Alltagsrassismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Wolfgang Benz - Alltagsrassismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Alltagsrassismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alltagsrassismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Alltagsrassismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Alltagsrassismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Alltagsrassismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als brauchbare Kriterien zur Einordnung politischen Verhaltens kann man die gedanklichen Inhalte, die angestrebten Ziele und die zu deren Erreichen angewandten Methoden benützen. Die drei Kategorien Gesinnung, Zielsetzung, Methoden liefern einigermaßen sichere Indizien für rechtsextremes Denken und Verhalten. Wichtige Kriterien für die Definition von Rechtsextremismus sind:
Nationalismus in aggressiver Form, verbunden mit Feindschaft gegen Ausländer, Hass gegen Minderheiten, fremde Völker und Staaten; militant-deutschnationales, deutschvölkisches oder alldeutsches Gedankengut,
Antisemitismus und Rassismus, biologistische und sozialdarwinistische Theorien und Überzeugungen,
Intoleranz, Unfähigkeit und Unwille zum Kompromiss in der politischen Auseinandersetzung, elitär-unduldsames Sendungsbewusstsein und Diffamierung Andersdenkender,
der Glaube an ein „Recht durch Stärke“,
Militarismus, das Streben nach einem System von „Führertum“ und bedingungsloser Unterordnung und nach einer entsprechenden autoritären oder diktatorischen Staatsform,
Verherrlichung des NS-Staats als Vorbild und Negierung oder Verharmlosung der unter nationalsozialistischer Ideologie begangenen Verbrechen,
Neigung zu Verschwörungstheorien (z. B. die Annahme, Regierung, Wirtschaft, Gesellschaft usw. seien durch irgendwelche bösartigen Minderheiten korrumpiert),
Verweigerung historischer, politischer, sozialer Realität,
latente Bereitschaft zur gewaltsamen Propagierung und Durchsetzung der erstrebten Ziele,
Anwendung der Methode des populistischen Appells an ein Publikum, dem das Bewusstsein der Mehrheit und der richtigen Gesinnung vermittelt wird, bei gleichzeitiger Stigmatisierung von „Feinden“,
Ungezügelter Drang nach Macht und Geltung, der verantwortungslos ausgelebt wird.
Monokausale Welterklärungen und Problemlösungsangebote, die Ablehnung pluralistischer Gesellschaftsmodelle, klare Feindbilder und das dadurch vermittelte Gemeinschaftsgefühl machen rechtsextremes Denken zur Artikulation von Protestverhalten attraktiv.
Zum geschlossenen Weltbild verdichtete sich rechtsextremes Denken in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Strömungen wie Sozialdarwinismus, völkischer Rassismus, Antisemitismus flossen mit aktuellen politischen Feindbildern, mit Verlustängsten und auf Revision und Revanche zielendem Nationalismus zusammen und bildeten eine antidemokratische und antiliberale neue Weltanschauung, die sich erst deutsch-völkisch nannte und dann den Begriff Nationalsozialismus übernahm. Die äußeren sozialen, ökonomischen und politischen Umstände begünstigten die Entwicklung der Ideologie, zu deren Durchsetzung Gewalt ausdrücklich propagiert und angewandt wurde.
Die rechte Ideologie, der Glaube an die eigene Überlegenheit, an das Herrenmenschentum, an die Ungleichheit der Menschen ist also nicht neu. Diese Überzeugungen haben den Hitlerstaat überlebt, sie sind scheinbar bestätigt und ermuntert durch soziale Spannungen, durch Unsicherheit und existentielle Ängste. Dazu gehört die Gewalt auf den Straßen, die gegen Minderheiten, Ausländer und Andersdenkende gerichtet ist, die medienwirksame Selbstinszenierung von Neonazi-, Skinhead- und Faschogruppen, und die politische und soziale Situation, in der Rechtsextreme agieren und Sympathisanten rekrutieren. Dazu gehören Populismus und Demagogie.
Die Angebote von Organisationen und Ideologen entsprechen verbreiteten Stimmungen. In Parteiprogrammen, Zeitungen, Reden und im Internet wird das Verlangen nach der heilen Welt verkündet. Als politischer Kraftquell werden dazu irrationale Sehnsüchte und romantische Illusionen benutzt. Empfindungen haben den Vorrang vor rationaler Weltsicht, Affekte sind den Demagogen wichtiger als Argumente. Die Angst vor intellektuell nicht erfassbaren Bedrohungen durch nicht begreifbare Strukturen der politischen, ökonomischen und sozialen Realität der modernen Informationsgesellschaft wird durch schlichte Rezepte und Schuldzuweisungen genährt.
Mit der Gewalt auf den Straßen, Anschlägen auf Mahnmale und Friedhöfe und auf KZ-Gedenkstätten geht die Verleugnung historischer Realität einher. Das zeigen die Diskurse in den sozialen Medien: Trotzig und zunehmend dreister behaupten die einen, die Schrecken der Verfolgung von Dachau bis Auschwitz hätte es gar nicht gegeben, andere bezweifeln den Umfang der Verbrechen, oder wollen sie mit Grausamkeiten alliierter Kriegsführung gegen Deutschland aufrechnen. Und monoton ertönt seit Jahrzehnten, einst bei der NPD, jetzt bei der „Alternative für Deutschland“ der Ruf nach einem Schlussstrich unter die Erinnerung. Gegen Muslime wird gehetzt, sie werden wie einst die Juden als angeblich feindselige Minderheit diskriminiert und als Sündenböcke in Anspruch genommen.
Feindbilder spielen eine zentrale Rolle bei der Definition rechtsextremer Programme. Mit Feindbildern werden aber auch die Brücken geschlagen vom politischen Extremismus zu den alltäglichen Sorgen der Bürger. Über Feindbilder und Verschwörungsphantasien lassen sich Existenzängste und Furcht vor gesellschaftlicher Deklassierung in Zeiten, die von ökonomischer Unsicherheit und sozialem Stress charakterisiert sind, artikulieren und in politische Aktion umsetzen. Das praktiziert die vulgäre Pegida-Bewegung mit Stimmungsmache gegen Muslime und die „Lügenpresse“, und das propagiert die AfD unter dem Jubel von Gesinnungsgenossen.
Rechtsextremes Denken wird aus vielen Wurzeln gespeist, wobei Realitätsverweigerung gegenüber geschichtlicher Erfahrung und Gewaltlatenz wesentliche Faktoren sind. Rechtsextremes Denken ist bestimmt von aggressiven Phantasien mit rassistischen, nationalistischen und militaristischen Inhalten; rechtsextreme Ideologien propagieren die Ausgrenzung von Minderheiten, den Glauben an Recht durch Stärke, politische und gesellschaftliche Ordnung durch „Führertum“ und „Gefolgschaft“. Zum aktuellen Phänomen des Rechtsextremismus gehört seine Militarisierung durch eine Generation, die keine lebensgeschichtliche Erfahrung mit der Realität des Nationalsozialismus und seinen unmittelbaren Folgen hat, ihn aber als politisches Ideal begreift. Rechtsextremes Denken speist sich aus Angst und Gefühlen des Bedrohtseins: Das Plädoyer für „einfache Lösungen“ angesichts unübersichtlicher Problemzusammenhänge, schwieriger Situationen und ökonomischer und sozialer Krisen gehört zum elementaren Politikverständnis im Rechtsextremismus. Es äußert sich in Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Ablehnung von Kompromiss und Toleranz und in zunehmender Gewaltbereitschaft.
Populismus: Techniken der Verhetzung
Man nannte sie früher Demagogen, d.h. Aufwiegler, heute wird Volksverhetzung mit dem Wort Populismus umschrieben und verharmlost. Die Erscheinung selbst, Stimmung für politische Interessen zu machen und dazu Ressentiments zu stimulieren, die Sachverhalte vereinfachen und verallgemeinern, Schuldige denunzieren und damit vermeintliche Erklärungen für komplizierte Probleme anbieten, ist nicht neu. Adolf Hitler predigte in den Anfängen der NSDAP nach dem Ersten Weltkrieg seinen von Ängsten geplagten Zuhörern, dass die Juden an Deutschlands Unglück schuld seien, dass die Deutschen mehr Lebensraum bräuchten und dass „Rasse“ und „Volksgemeinschaft“ die höchsten Werte und dass „Fremde“ gefährlich seien.
Die Gefolgschaft der Populisten, die Pegidademonstranten und die Wähler der AfD legen Wert auf bürgerlichen Habitus und sie wollen sich nicht als rechtsextrem beschimpfen lassen. Aber auch sie sollten begreifen, dass die Lehren aus der Katastrophe des Nationalsozialismus für den Umgang mit allen Minderheiten gelten müssen. „Fremde“ dürfen nicht als Störenfriede spießbürgerlichen Behagens und dumpfpatriotischen Selbstgenügens stigmatisiert werden. Der Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im Stress der Wende 1992 war ein Menetekel. Brennende Wohnheime von Asylbewerbern, grölende und gegen verängstigte Flüchtlinge pöbelnde Dorfbewohner wie in Clausnitz, jubelnde Fremdenfeinde in Bautzen, die Feuerwehrleute am Löschen einer brennenden Flüchtlingsunterkunft hindern wollen sind Zeichen einer vom Populismus geschürten Menschenfeindlichkeit, die zutiefst erschreckt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Alltagsrassismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Alltagsrassismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Alltagsrassismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.