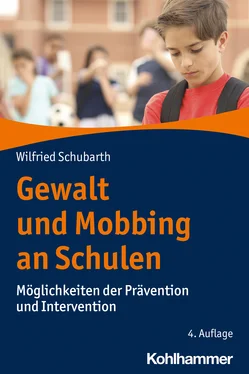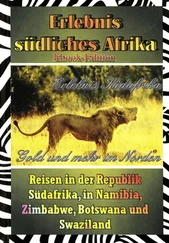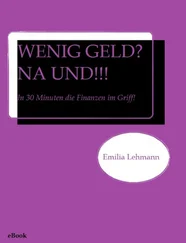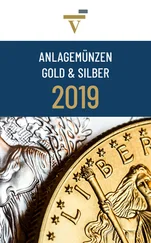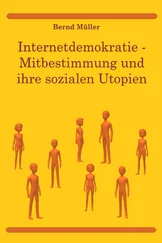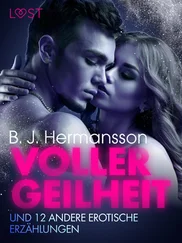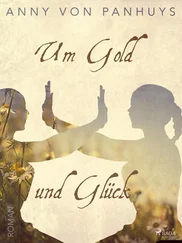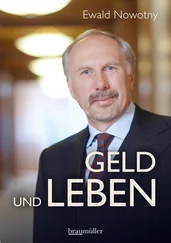Im Vergleich zur Lehrersicht sieht die Schülerschaft das Lehrerhandeln bei Gewalt und Mobbing deutlich kritischer: Eines der auffälligsten Ergebnisse ist der Befund, dass rund 30 % der Schülerinnen und Schüler berichten, dass die Lehrkräfte von dem von ihnen berichteten Fall nichts erfahren haben. Dass Lehrkräfte nicht alles erfahren, ist nicht unerwartet; dass aber immerhin jeder dritte bis vierte Gewalt- bzw. Mobbingfall ihnen nicht zu Ohren kommt, weist auf einen erheblichen Handlungsbedarf hin. Mehr noch: Jede zehnte Lehrkraft hat – aus Schülersicht – nichts unternommen und das Geschehen nicht weiter beachtet. Bei fünf Prozent der Fälle wurde der Mobbingfall sogar bagatellisiert. Weitere 14 % gaben an, dass die Lehrkräfte die Situation nur beobachtet haben. Umgekehrt haben in ca. 70 % der geschilderten realen Gewalt- oder Mobbingsituationen, von denen eine Lehrkraft erfahren hat, die Lehrkräfte auch interveniert.
Welche Hintergründe es dafür gibt, dass Lehrkräfte von Gewalt- und Mobbingfällen nichts erfahren und dass ein kleinerer Teil der Lehrkräfte bei Gewalt und Mobbing nicht eingreift, kann nur vermutet werden. Anzunehmen ist, dass das Klassen- und Schulklima, insbesondere die Lehrer-Schüler-Beziehung, aber auch der Professionalisierungsgrad der Lehrkräfte wie des gesamten Lehrerkollegiums, einschließlich der Schulleitung, wichtige Einflussgrößen darstellen.
Welche Interventionsstrategien sind erfolgreich?
Unsere Studie (Bilz/Schubarth/Dudziak u. a. 2017) liefert auch Antworten auf die Frage, wie und mit welchem Erfolg Lehrkräfte in Gewalt- und Mobbingsituationen agieren. Die mit Abstand häufigste Interventionsform ist das Gespräch mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern. Mit deutlichem Abstand folgen kleinere Interventionen wie Gesten oder Mimiken, Maßnahmen auf Klassenebene oder Disziplinierungsmaßnahmen. Dagegen sind Kooperationen mit anderen Personen, emotionale Unterstützung oder langfristige Maßnahmen auf Klassen- bzw. Schulebene eher selten. Diese Befunde sind im pädagogischen Kontext ambivalent zu sehen: Einerseits sind Gespräche immer ein probates pädagogisches Mittel, Konflikte zu regeln; andererseits lässt die geringe Orientierung an kooperativen Ansätzen auf fehlendes kollegiales Zusammenwirken und folglich auf eine ungenügende Reichweite der Maßnahmen schließen.
Probleme aufgrund einer mangelnden pädagogischen Professionalität beim Umgang mit Gewalt und Mobbing werden auch bei einem Vergleich von Lehrer- und Schülerperspektive deutlich. So berichten Schülerinnen und Schüler – im Vergleich zu Lehrkräften – deutlich häufiger davon, dass bei Gewalt- bzw. Mobbingfällen autoritär-strafend eingegriffen wird, also z. B. mit Drohungen, Sanktionen und Disziplinierungen. Mehr als jeder vierte Schüler berichtet von solchen autoritär-strafenden Interventionen; bei den Lehrkräften ist dies nur etwa jede sechste Lehrkraft. Fremd- und Selbstbild gehen bei der Art der Inventionen offenbar ein Stück weit auseinander – Anlass genug, sich über unterschiedliche Wahrnehmungen auszutauschen.
Der relativ hohe Anteil autoritär-strafender Maßnahmen ist zum Teil problematisch; autoritär-strafende Maßnahmen sind beim Umgang mit Gewalt und Mobbing meist nicht zielführend. Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler gelingt es Lehrkräften mit unterstützend-kooperativen Interventionen (z. B. Kollegen hinzuziehen, Peer-Mediation, die gesamte Klasse einbeziehen) deutlich häufiger, das Mobbinggeschehen zu beenden als mit unterstützend-individuellen Interventionen (z. B. Gespräche mit den unmittelbar Beteiligten) und auch mit autoritär-strafenden Mitteln. Will man Gewalt und Mobbing nachhaltiger begegnen, müssten somit unterstützend-kooperative Interventionen aus- und im Gegenzug autoritär-strafende Maßnahmen abgebaut werden. Hier können Fortbildung und Schulentwicklungsprozesse ansetzen.
Bei der Bewertung des Interventionserfolges ergeben sich weitere Differenzierungen , z. B. nach dem Status im Mobbinggeschehen. So bewertet die Gruppe der Unbeteiligten den Erfolg am höchsten, gefolgt von den Mobbingopfern und den Mobbingtätern. Der harte Kern, die Gruppe der Täter-Opfer, die sowohl Täter- als auch Opfererfahrungen machen, bewertet den Erfolg am niedrigsten. Hier bedarf es weiterer Überlegungen, wie mit dem harten Kern umgegangen werden kann. Offenbar ist diese Gruppe mit den bisherigen Strategien nur schwer zu erreichen.
Welche Interventionskompetenzen brauchen Lehrkräfte?
In unserer Studie (vgl. Bilz/Schubarth/Dudziak u. a. 2017) konnten vor allem drei Kompetenzen als Prädiktoren für eine erfolgreiche Lehrerintervention identifiziert werden: erstens die Breite des Gewaltverständnisses, d. h. welche Phänomene im subjektiven Verständnis der Lehrkräfte als »Gewalt« angesehen werden, zweitens die Diagnosekompetenz der Lehrkräfte hinsichtlich des Opfer- bzw. Täter-Status ihrer Schüler und drittens die Empathiefähigkeit der Lehrkräfte.
Beim Gewaltverständnis zeigt sich, dass Lehrkräfte vor allem dann intervenieren, wenn ihr Verständnis von Gewalt breit ist, sie z. B. auch soziale Ausgrenzung und Hänseleien als Gewaltphänomene ansehen. Lehrkräfte, deren Gewaltverständnis enger ist und sich z. B. auf körperliche Gewalt beschränkt, greifen auch seltener bei Mobbing ein. Das Gewaltverständnis der Lehrkräfte hat Folgen für die Schulklassen: In den Klassen von Lehrkräften mit einem breiten Gewaltverständnis gibt es deutlich mehr Mädchen und Jungen, die bei einer Mobbingsituation intervenieren würden als in Klassen von Lehrkräften mit einem engen Gewaltverständnis.
Hinsichtlich der Diagnosekompetenzen von Lehrkräften lässt sich Folgendes feststellen: Fragt man Lehrkräfte konkret, welche Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen Täter oder Opfer sind, fällt ihnen die Identifikation der Beteiligten recht schwer – und zwar für beide Gruppen gleichermaßen. Dass ihnen die Identifizierung aber bei den besonders leistungsstarken und den leistungsschwachen Lernenden besser gelingt, ist ein Indiz dafür, dass sie die Schüler vor allem unter Leistungsgesichtspunkten wahrnehmen. Die geringe Genauigkeit des Lehrerurteils lässt die Arbeit an den entsprechenden Diagnosekompetenzen notwendig erscheinen.
Weiterhin ist die Fähigkeit zur Perspektivübernahme eine wichtige Ressource für den kompetenten Umgang mit Schülermobbing. So verfolgen empathische Lehrkräfte mit ihren Interventionen in Mobbingsituationen langfristigere Ziele und erreichen diese auch eher als weniger empathische Lehrkräfte. Darüber hinaus ist das Wissen über Gewalt bzw. Mobbing von Bedeutung. So geht ein Fortbildungsbesuch mit einem erlebten Wissenszuwachs und einer erhöhten subjektiven Kompetenzeinschätzung einher. Die Bedeutung von Fortbildungsbesuchen wird auch durch den Befund untermauert, dass Lehrkräfte, die eine Fortbildung zu Gewalt bzw. Mobbing besucht haben, fast doppelt so häufig in Mobbingsituationen intervenieren als Lehrkräfte, die keine Fortbildung besucht haben. Neben dem Wissen hat auch die Selbstwirksamkeit Einfluss auf die Lehrerintervention. Lehrkräfte mit einer hohen Selbstwirksamkeit, also höherem Zutrauen in die eigenen Handlungsmöglichkeiten, intervenieren häufiger und zielen mit ihren Interventionen zudem häufiger auf langfristige Veränderungen ab, wie beispielsweise die Verbesserung des Klassenklimas.
Resümierend ist festzustellen, dass das Gros der Lehrkräfte bei Gewalt und Mobbing interveniert. Diese erfreuliche Nachricht ist jedoch mit der Forderung zu verbinden, Lehrkräfte für Mobbing stärker zu sensibilisieren und nachhaltige Interventionsstrategien, vor allem kooperativer Art, zu fördern. Da die Überzeugungen und das Vorbild der Lehrkräfte einen Einfluss auf das Schülerhandeln haben, sollten auch Lehrerüberzeugungen und das Interventionshandeln in den Fokus der Prävention rücken. Darüber hinaus verweist der Befund, dass ein beachtlicher Teil der Mobbingfälle nicht zu den Lehrkräften gelangt, auf die Notwendigkeit, stärker an einer vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Beziehung zu arbeiten. Ein gutes Schul- und Klassenklima und ein ganzheitliches Verständnis der Schülerpersönlichkeit sind dafür wichtige Voraussetzungen. Intervention und Prävention von Gewalt bzw. Mobbing bleiben somit auch künftig zentrale Aufgaben von Schulen. Eine nachhaltige Anti-Gewaltstrategie bedarf dabei der engen Verknüpfung von Prävention bzw. Intervention mit Schulentwicklungsprozessen. Die Politik ist aufgerufen, dafür die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Читать дальше