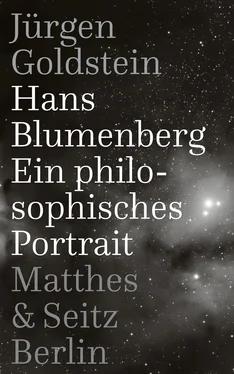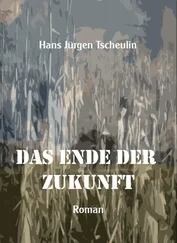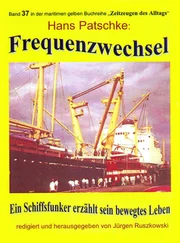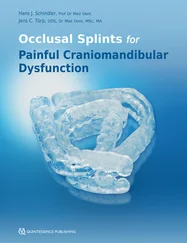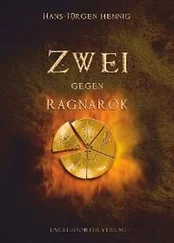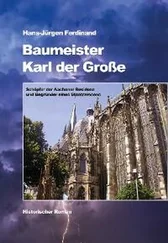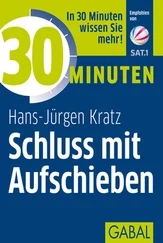Da sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Vernichtungsterror nichts mehr von selbst verstand, wurde auch die Frage nach der Zeit, in der man lebt, die Vergewisserung über die geschichtliche Epoche aus ihrer Latenz herausgerissen. »Man hatte sich«, so Blumenberg, schon nach dem Ersten Weltkrieg »außer um das eigene Leben – und im Zweifel an dessen Sinn – um das Zeitalter zu kümmern. Diese Bekümmerung, die ›Erlebnis‹ zu nennen man nicht mehr wagte, nahm den Titel ›Geschichtlichkeit‹ an.« 103Zum Vergleich: Karl Jaspers hat sich im Rückblick auf seine Studienzeit vor dem Ersten Weltkrieg an die noch unerschütterte Stabilität lebensweltlicher Gewissheiten erinnert: »Meine Reflexionen als Student darüber, daß es so, wie es jetzt ist, für unsere Lebenszeit bleiben werde, bedeuteten, sich nicht um das Zeitalter zu kümmern. Es hatte nur ein beiläufiges Interesse. Das Leben hatte seinen Sinn nicht für diese Zeit. Der Sinn war zeitlos.« 104Davon konnte nun keine Rede mehr sein. Schon 1931 fühlte sich Jaspers gedrängt, von der Geistigen Situation der Zeit Zeugnis abzulegen und mit diesem Stichwort das Denken auf seine Geschichtlichkeit zu verpflichten. Konsequent forderte er als bedeutende Integrationsfigur Nachkriegsdeutschlands, die Philosophie müsse nun »konkret und praktisch werden«. 105Schock und Aufbruch in all diesen Köpfen, moralische und politische Verpflichtung auf einen antifaschistischen Neuanfang. Die deutsche Philosophie stand vor der Herausforderung, neu ansetzen zu müssen, die zerstörten Universitäten ebenso wie das eigene Denken neu zu errichten.
Vor diesem Hintergrund ist die 1950 in Kiel bei Ludwig Landgrebe und Walter Bröcker eingereichte, 233 Seiten umfassende Habilitationsschrift Blumenbergs, die den Titel Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls trägt, bemerkenswert. Blumenberg teilte die kognitive Unruhe eines notwendig gewordenen Neuanfangs, und wie für Arendt und Habermas, Sternberger und Jaspers galt es auch für ihn, der Erfahrung der geschichtlichen Bedingtheit des Augenblicks durch ein ursprüngliches philosophisches Denken die Treue zu halten. In dieser Verpflichtung entdeckte er etwas, das ihn einen eigenen Denkweg einschlagen ließ: »Daß die Philosophie von der Bedrängnis der je gegenwärtigen geistigen Situation in Atem gehalten wird«, beginnt er seine Habilitationsschrift, »und ihre Probleme aus der Not des geschichtlichen Selbstverständnisses des Menschen vorgeworfen erhält, ist ihr selbst über weiteste Strecken ihrer Geschichte hin durch den Schein der Zeitentzogenheit ihrer Grundthemen verborgen geblieben. Hatte das Denken nicht schon am Anfang der für uns deutlichen Geschichte seine großen Fragen aufgeworfen – oder besser: aufgefunden – und sie in der inneren Zwangsläufigkeit des entfaltenden Nacheinander von Problem, Lösung, Aporie durchgetragen? Gab es in irgendeiner anderen Disziplin eine auch nur entfernt vergleichbare Kontinuität? Sollte dies aber Schein sein – wo sollte man einen Standort finden, von dem aus er als solcher durchschaubar würde, da doch die Philosophie schon der äußerste aller denkbaren Standorte war? Die Geschichtlichkeit der ›Geschichte‹ der Philosophie mußte das verborgenste, vielleicht letzte Thema der Philosophie sein. Zu ihm gab es keinen methodischen Zugang, keinen Hinweis aus den Leerstellen eines Systems, nicht den Anstoß einer Aporie; denn nirgendwo sonst ließen sich historische Zusammenhänge größter Tiefenerstreckung so geradlinig ins Zulaufen auf die jeweilige Gegenwart ein›richten‹, so bestätigend zur Vorläuferschaft dienstbar machen wie hier. Das ist gewiß nicht bloßer Zufall oder Folge besonderer Gewaltsamkeit; es deutet darauf hin, daß ›Geschichte‹ der Philosophie sich wirklich auf den Grund einer Einheit beruft. Daß aber diese Einheit gerade nicht das war, als was sie je von den Philosophien und Systemen in Anspruch genommen wurde, nämlich der bloße Vorlauf auf die je aktuelle Gegenwart des Denkens – diese Einsicht konnte nur selbst als Erfahrung eines geschichtlichen Geschicks durchbrechen.« 106
Es gibt also eine ›Geschichte‹ der Philosophie – von Blumenberg in Anführungszeichen gesetzt, wenn mit ihr jene Kontinuität traditioneller Begrifflichkeit gemeint ist –, die eine Einheit des philosophischen Denkens begründet, trotz aller schul- und epochenmäßigen Ausdifferenzierungen. Aber es gibt auch einen geschichtlichen Hintergrund der ›Geschichte‹, der sich als ›Geschick‹ ereignet, der in die Kontinuität einbricht, ursprüngliches Bedenken der Situation erfordert und die vordergründige Kontinuität infrage stellt. Daher spricht Blumenberg von der ›Geschichtlichkeit der Geschichte‹. Auch andere Texte der unmittelbaren Nachkriegszeit sind von jenem Tenor der erwachten Geschichtlichkeit als existenzieller Erfahrung geprägt. Gerhard Krüger, um einen Autor heranzuziehen, den Blumenberg seinerzeit gelesen und zitiert hat, schreibt 1947 in seinem Zeitkommentar Die Geschichte im Denken der Gegenwart davon, die Geschichte sei »heute unser größtes Problem «, es sei »unser dringendstes, unser umfassendstes und unser schwierigstes« und das » dunkelste aller Probleme« und somit ein »philosophisches Grundproblem«. 107Doch während Krüger, einen drohenden dritten Weltkrieg im Blick, die ihm gegenwärtige Geschichte als eine »Situation der Gefährdung« 108begreift, überschreitet Blumenberg philosophisch den gedankenauslösenden Kontext, um nach der Verfasstheit von Geschichte überhaupt zu fragen. Es darf als eine eigene Form intellektueller Selbstbehauptung genommen werden, sich von der biographisch-zeitgeschichtlichen Situation nicht dauerhaft das philosophische Fragen bestimmen zu lassen.
Blumenberg schlägt daher einen eigenen Reflexionsweg ein. Dabei fällt auf, wovon er nicht spricht. Zum Vergleich: Arendt kam es nach den Katastrophen, die jedes erwartbare Maß übertroffen hatten, darauf an, »die Grundlagen einer neuen politischen Moral zu schaffen«, 109Sternberger wurde für die junge Bundesrepublik zu einem wichtigen Wegweiser in die Verfahren einer uneingeübten Demokratie, und Habermas stellte der totalitären Gleichschaltung das ›kommunikative Handeln‹ entgegen. Blumenberg aber hat sich weder in seiner Habilitationsschrift noch in seinem weiteren Werk prominent zu Fragen der Moral und des Politischen geäußert, schon gar nicht hat er sich mehr als punktuell über seine eigenen biographischen Umstände im Dritten Reich ausgelassen. Auch er sieht die Aufklärung als gescheitert an – was das genau bedeutet, wird noch zu zeigen sein –, aber er begreift sie nicht vorrangig als ein moralisch-politisches Emanzipationsprojekt, sondern als den Erkenntnisanspruch absoluter Gewissheit und zieht daher aus ihrem Scheitern alternative Schlüsse. Eine Dialektik der Aufklärung , wie sie Horkheimer und Adorno gedacht haben, eine fundamentale Kulturkritik im Sinne einer kritischen Theorie also mit der Selbstverpflichtung auf gesellschaftliche Relevanz, ist Blumenberg ebenso fremd geblieben wie der später erhobene Primat der Praxis gegenüber aller Theorie. Blumenberg trieben andere Fragen um.
Heidegger hatte in Sein und Zeit von dem In-der-Welt-sein gesprochen und damit eine unhintergehbare Grundverfassung des menschlichen Lebens bezeichnet. Blumenberg betont in seinen einleitenden Ausführungen, für den Menschen sei ein immer schon In-der-Geschichte-sein anzunehmen, denn »das Wesen des menschlichen Denkens ist gerade darin geschichtlich, daß es immer schon ›entschieden‹ ist. Solche Entschiedenheit tritt im Modus der Selbstverständlichkeit auf und entzieht sich darin jeder Infragestellung«. 110Die durch die Geschichte erfolgte und unbemerkte Vorprägung jeder denkerischen Position ist nicht beliebig und aus eigenem Antrieb reflektierbar, sondern es bedarf des Anstoßes, der Unterbrechung durch eine Zäsur, um die geltende Evidenz zu erschüttern. Eine solche Zäsur, die die Ursprünglichkeit von Geschichte freisetzt, ist der Zusammenbruch der ontologischen Distanz als angestrebter Gewissheit.
Читать дальше